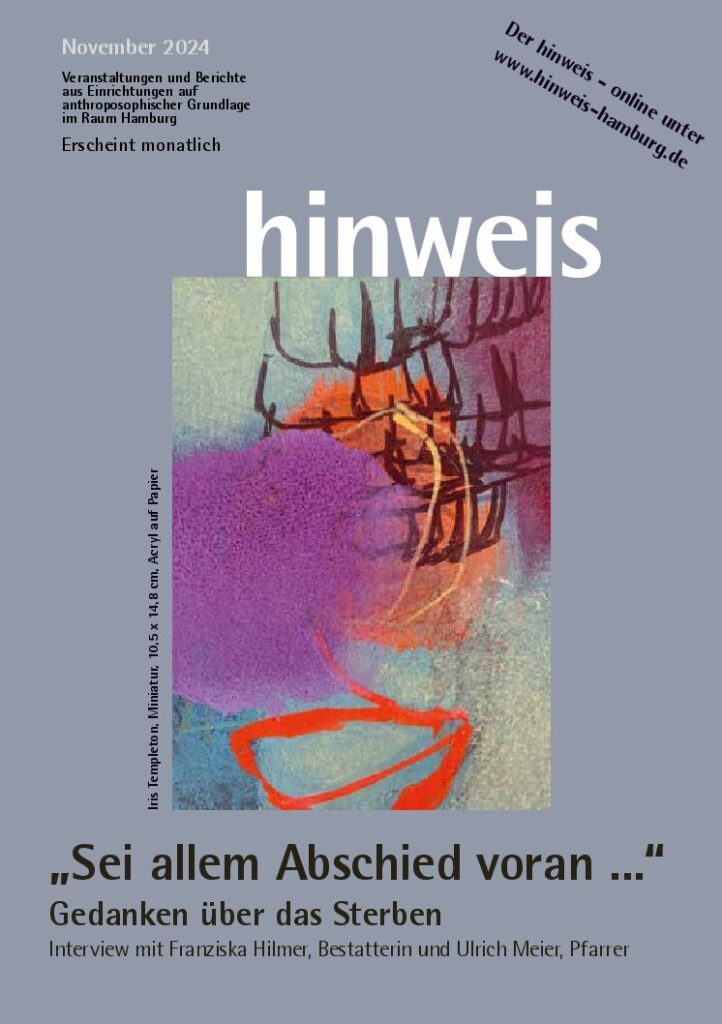Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
100 Jahre Christengemeinschaft
Vergangenheit, Gegenwart, Entwicklungen
Interview mit Eva Bolten, Studentin am Priesterseminar, Frank Hörtreiter, Christian Bartholl, beide Pfarrer der Christengemeinschaft



Was ist die Grundgeste von Religion? Wofür brauchen wir Menschen sie im 21. Jahrhundert? Die Christengemeinschaft hat in den letzten 100 Jahren ein religiöses Leben aufgebaut. Vieles hat sich in dieser Zeit verändert. Beginnend mit der Gründung nach dem ersten Weltkrieg, dann in den Wirrungen der Nazizeit und nach den konservativen Nachkriegsjahren hat sie sich heute zu einer paritätischen Gemeinschaft entwickelt, in der Mitglieder in Zusammenarbeit mit der Priesterschaft das Gemeindeleben gestalten. Die Freiheit des Einzelnen und ein individuell entwickeltes Verhältnis zur göttlichen Welt bilden die Grundlage für die Zusammenarbeit in einer Gemeinschaft. Dabei ist die Ausführung der Sakramente der zentrale und bleibende Kern in allen diesen Verwandlungen.
Interviewpartner:in:
Eva Bolten: geb. 1989, Studium der Psychologie (Bachelor o Sc.), Ausbildung zur Gärtnerin – Gemüsebau, im Anschluss Arbeit als Gärtnerin in der Hofgemeinschaft Weide-Hardebek, seit 2019 Studentin am Priesterseminar Hamburg, seit 2021 Mitarbeiterin am Priesterseminar Hamburg.
Frank Hörtreiter, geb. 1944, Studium der klassischen Philosophie und am Priesterseminar der Christengemeinschaft. Seit 1969 verheiratet, seit 1970 Priester, seit über 15 Jahren Öffentlichkeitsbeauftragter der Christengemeinschaft. Tätig als Pfarrer in Hamburg von 1970-1973 und 1996-2006, dazwischen 23 Jahre in Hannover und in Stuttgart; die letzten 14 Jahre wieder in Hannover; seit 5 Jahren emeritiert. Autor der Studie „Die Christengemeinschaft im Nationalsozialismus“, schreibt „die Geschichte der Christengemeinschaft.“
Christian Bartholl wurde in Stade geboren, 2006 als Pfarrer geweiht, 5 Jahre war er tätig in München und ist seit 9 Jahren in Hamburg-Volksdorf. Seit 4 Jahren trägt er Verantwortung für die Christengemeinschaft Norddeutschland. Er war im früheren Beruf Grafik-Designer und arbeitete für Zeitschriften- und Buchverlage.
Christine Pflug: Wie ist vor 100 Jahren die Christengemeinschaft entstanden? Was war die Zeitsituation, welches waren die Bedingungen?
Frank Hörtreiter: Es gab eine Gruppe von Menschen, die sich damals aber noch nicht kannten, und die suchten eine religiöse Erneuerung. Diese Suche war durch einen Mangel und einen Aufbruch bestimmt. Die etablierten Kirchen waren in der Gründerzeit festgelegt und in den Formen völlig erstarrt, hatten ihre Machtansprüche und der Kaiser beispielsweise betonte damals in seinen Reden, dass er „summus episcopus“, der oberste Bischof sei. Das war alles einerseits so verfestigt, hohl und überzogen und andererseits waren die Menschen durch die kritische Bibelwissenschaft der Meinung: Das, was man als Christ noch glauben kann, passt bequem auf eine Postkarte, d. h. der größte Teil der Bibel ist verfälscht oder falsch verstanden. Das alles war in der katholischen Kirche noch etwas schärfer, weil sich kurz davor der Papst die Unfehlbarkeit zugemessen hatte und auch problematische Weise Dogmen verkündet hatte. Das alles hatte dazu geführt, dass sich die Menschen fragten: „Was soll das? Eine hohle Form und ein ärmlicher Inhalt – das kann es doch wohl nicht sein!“ Dazu kam in dieser Zeit eine Aufbruchsstimmung, z. B. die Jugendbewegung, die Wandervögel, Sehnsucht nach spirituellen Erlebnissen; auch war es sehr in Mode, mit geistigen Wesen zu verkehren (siehe Artikel im Hinweis Januar 2022 über Hilma af Klint). Die Menschen hatten ein Bedürfnis, das die etablierten Kirchen nicht beantworten konnten und vielleicht, so meinten sie, könne es ja Rudolf Steiner. Und der hatte jahrelang auf die Frage gewartet; er wollte ja nie etwas begründen, wenn es nicht ausdrücklich erbeten wurde. 1922 gab es endlich genug Menschen, die wirklich diesen religiösen Aufbruch wollten. Damit stand die Christengemeinschaft aber nicht alleine. Auch in der evangelischen und katholischen Kirche hatte man das Gefühl, man müsse neu aufbrechen: Der Krieg ist vorbei, die alten Illusionen sind geplatzt, die alten Prachtbauten tragen in Wahrheit nicht mehr, es muss etwas Neues beginnen!
Nicht einmal mehr die Hälfte der deutschen Bundesbürger sind heute Mitglieder in den Kirchen
C. P.: Da könnte man bemerken, dass wir da heute auch wieder stehen.
F. Hörtreiter: So sehe ich das auch! In den Medien kam die Meldung, dass neuerdings nicht einmal mehr die Hälfte der deutschen Bundesbürger zu den Kirchen als Mitglieder gehören. Die heutigen Formen sind weniger vertrauenswürdig, und andererseits gibt es ein Bedürfnis nach Spiritualität unter den Menschen.
C. P.: Sie haben sich ausführlich mit der Geschichte der Christengemeinschaft vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt ¹. Können Sie in Kurzfassung die weitere Entwicklung nach der Gründung schildern?
Wir haben dem Rad nicht genug in die Speichen gegriffen
F. Hörtreiter: Ich benenne erst mal das Klischee, gegen das ich angeschrieben habe: Die Christengemeinschaft war verfolgt und wurde verboten, also waren wir auf der richtigen Seite und haben alles richtig gemacht. Das stimmt so nicht! Wir waren zwar verfolgt, aber wer kann angesichts dieses Leides, was damals über die Menschen, speziell über die Juden, gekommen war, sagen, er hätte alles richtig gemacht? Da bleibt immer ein Mangel. Ich stimme darin mit Bonhoeffer überein, dass wir dem Rad nicht genug in die Speichen gegriffen haben. Für die Christengemeinschaft gibt es dafür auch einen Grund: Friedrich Rittelmeyer, der damalige Leiter, war immer darauf aus, dass sich die Christengemeinschaft rein auf das Religiöse beschränken solle, dass vor dem Altar Frieden herrschen solle, dass der SA-Mann und der Kommunist gleichermaßen nebeneinander friedlich zur Kommunion gehen dürfen. Insofern haben wir damals nicht den großen Widerstand geleistet, auch wenn wir uns zwischen den Zeilen geäußert haben. Wir waren damals noch sehr klein und fühlten uns mit Recht bedroht. Die Nazis waren nämlich der Meinung, was sich nachweisen lässt, wir seien gefährlicher als die Großkirchen. Die Christengemeinschaft hat um ihr Überleben gekämpft, und es gab nur ein paar rote Linien. Die wichtigste war: Jeder ist am Altar willkommen; wir haben die nicht Juden aus den Gemeinden geworfen, keiner der Pfarrer war ein Nazi, abgesehen von einem merkwürdigen Irrläufer. Allerdings gab es die bei den Mitgliedern – bei uns sollte jede:r seine Heimat finden können. Rittelmeyer hoffte, dass die dann eine bessere Gesinnung entwickeln würden, aber diese Hoffnung war meistens vergebens. 1941 wurden wir dann verboten, und die Pfarrer kamen ins Konzentrationslager oder ins Gefängnis, aber man kann uns trotzdem nicht zu Widerständlern stilisieren. Wir waren keine Märtyrer.
C. P.: Was war der Grund, warum man damals die Christengemeinschaft so gefährlich fand?
Radikal individualistisch
F. Hörtreiter: Die Nazis hatten einen Slogan: Du bist nichts, dein Volk ist alles. Die Christengemeinschaft war und ist radikal individualistisch, sie schätzt die Freiheit des Einzelnen immer höher, und der Einzelne ist immer wertvoller als das Kollektiv. Es gab damals eine große Studie des Reichssicherheitshauptamtes, in der stand: Die Christengemeinschaft und die Anthroposophie sind im Verhältnis zum Nationalsozialismus wie Feuer und Wasser. Wir hatten nach deren Vorstellung auch Fürsprecher, die allerdings in einem irdisch-äußerlichen Sinne überschätzt wurden, z.B. Rudolf Hess, Erdmenger, Ruckteschell, Schmundt. Die Letztgenannten hatten sich für die religiöse Erneuerung eingesetzt.
C. P.: Wie ging es dann nach dem Krieg weiter?
F. Hörtreiter: Einer der Gründungspriester, Emil Bock, der immerhin im KZ gesessen hat, meinte: „Wir haben doch großes Glück gehabt. Wir können uns zweimal begründen. Beim ersten Mal 1922 haben wir so viel falsch gemacht, jetzt fangen wir ganz neu an.“ Wir hatten immer die Gesinnung: Wir dürfen alles infrage stellen und neu machen – der Kultus und die Sakramente sind das Einzige, was Heimat ist – , aber alles andere könnte auch ganz anders sein. Und das war nach dem Krieg, als die Stimmung einer Neuorientierung herrschte, auch angesagt, auch wenn die Ergebnisse gemessen an diesem radikalen Neubeginn ein wenig zu konventionell waren. Leider hatte man aber peinlich ausgeblendet, was im Dritten Reich war, auch bei denen, die sich zu den Opfern zählten. Die Stimmung war allgemein und auch bei uns: „Lass das Vergangene ruhen.“
Die Christengemeinschaft hatte sich 1945 nach dem Krieg neu gegründet. Sie hat ab dann alle Zeitstufen mitgemacht, die muffige Adenauerzeit mit ihrer Doppelmoral, dann die 68-er Unruhe, die Anti-Atomkraft-Bewegung, später den Interreligiösen Dialog. Es gab keine Zeitströmung, die wir nicht mitgemacht haben, zum Teil als Vorreiter. Beispielsweise waren wir als Kirche die Ersten, die Umweltschutz wichtig fanden und praktizierten.
C. P.: Das ist aber nicht so sehr in die allgemeine Öffentlichkeit gedrungen!?
F. Hörtreiter: Leider ja, wir sind immer ein wenig zu schwächlich und höflich und dadurch nicht so hörbar.
Christian Bartholl: In den 80-er und 90-er Jahren hatten die Gemeinden der Christengemeinschaft einen enormen Zuwachs. Menschen, die mit ihrem bisherigen spirituellen Milieu unzufrieden waren, haben sich der Christengemeinschaft zugewendet. In dieser Zeit sind viele Gemeinden gegründet worden oder größer geworden. Dann wurde in der gesellschaftlichen Entwicklung in den 2000-er Jahren eine Säkularisierung immer stärker bemerkbar, die Menschen hatten immer weniger Bezug zu einer Spiritualität. Das hatte natürlich Auswirkungen auf die Christengemeinschaft. Ich habe in dieser Zeit eine innere Wandlung erlebt, was das Priesterbild angeht: Der Pfarrer hat zwar eine zentrale Stellung in der Ausübung der Sakramente, aber die Mitglieder wollten immer mehr gemeinschaftlich das Gemeindeleben gestalten. Insofern würde ich sagen, dass in den 2000-er Jahren nochmal eine Verwandlung stattgefunden hat. Heute stehen wir an einem Punkt, wo die Arbeit, die in den letzten 20 Jahren geleistet wurde, ihre ersten Früchte trägt. Ich erlebe, dass die Menschen das Bedürfnis haben, immer mehr gefragt zu sein, mitzugestalten und an den Erfahrungen der anderen zu lernen. Das ist ein wichtiger Unterschied im Vergleich zu den klassischen, großen Kirchen, die eine starke Struktur haben; besonders in der katholischen Kirche hat der Klerus einen ganz großen Gestaltungsraum.
C. P.: Und mein Eindruck ist, dass die Pfarrer auch nicht mehr die unbestrittenen Autoritäten sind!
C. Bartholl: Genau. In der Vergangenheit wurden wie in der Gesellschaft vor allem pyramidale Führungsstrukturen gepflegt. Bei der Entstehung der Christengemeinschaft sind damals Formen übernommen worden, die aus dem klassischen evangelischen Gemeindebildungszusammenhang kamen, weil die meisten Gründer Protestanten waren. Eigentlich war ein ganz neuer Griff geplant. Die Christengemeinschaft wollte nicht auf den alten Formen aufbauen. Doch gesellschaftliche Konventionen wurden übernommen. Wir erleben auch heute, dass wir diese Traditionen hinterfragen müssen und schauen, was sich verwandeln lässt.
C. P.: Haben Sie für diese neuen Ansätze ein Beispiel?
C. Bartholl: Die klassische Gemeinde bildet einen Körper und ist in sich in einer relativen Weise abgeschlossen. Beispielsweise muss das Glaubensbekenntnis gesprochen werden, dann gehört man dazu. Die Taufe ist eine Voraussetzung für die Zugehörigkeit zur Gemeinde. Da ist die Christengemeinschaft viel offener. Das Glaubensbekenntnis muss nicht bekräftigt werden; wir würden von Menschen, die zu uns kommen, nicht fordern, dass sie getauft sein müssen; der Mitgliedsbegriff ist so, dass er die größtmögliche Freiheit für den Einzelnen zulässt. Man kann sich beispielsweise als Freund verstehen. Es lebt ein klassisches traditionelles Bild von einem Pfarrer; mit ihm arbeitet eine Pfarrersfrau, die dazugehört und mitgestaltet. Diese Rollenverhältnisse haben wir hinterfragt, und es gibt ganz unterschiedliche, individuelle Ausprägungen, wie einzelne Pfarrer ihr Leben im Zusammenhang mit der Gemeinde gestalten. Übrigens arbeiten in Norddeutschland mehr Frauen als Männer, die für eine Gemeinde verantwortlich sind.
F. Hörtreiter: Die Christengemeinschaft war früher eine reine Priesterkirche. Der Pfarrer legitimierte sich durch seine Armut, bestimmte aber alle Ausgaben. Das war, ohne dass man es beabsichtig hatte, zentralistisch. Inzwischen gibt es auf jeder Ebene ein Laiengremium, das den Pfarrern ebenbürtig auf Augenhöhe gegenüber steht: Gemeinde mit Pfarrer, Region mit Lenker, überregionale Leitung mit Siebenerkreis. Finanzentscheidungen entstehen zum großen Teil durch Nicht-Pfarrer. Das hätten die früheren Pfarrer als Entmachtung und gefährliche Entwicklung angesehen. Heute merken wir, dass wir ungeheuer entlastet sind, wenn die Mitglieder selbst die Verantwortung übernehmen. Wir sind auf dem guten Weg zu einer echten Parität, was man sich vor 40 Jahren noch nicht hätte vorstellen können.
C. P.: Frau Bolten, Sie sind in der Ausbildung auf der Suche nach zeitgemäßen Formen. Was ist dabei entstanden?
Eva Bolten: Im Hinblick auf die Ausbildung am Priesterseminar beschäftigen wir uns damit, welche Rolle für die Pfarrer:innen in der Gemeinde zeitgemäß ist. Die Ausführung der Sakramente ist einerseits der bleibende Kern, der die Grundlage des Gemeindelebens und des Wirkens der Priester bildet. Darüber hinaus besteht aber durchaus die Frage: Wie wird oder bleibt Gemeindebildung lebendig? Welche Wege müssen wir gehen, um in der Gemeinde zu einem lebendigen Miteinander zu kommen?
Ein „Ermöglichungsraum“
Hier sind die Führungskompetenzen der Priester gefragt, die wir in der Ausbildung am Hamburger Priesterseminar stärker in den Blick nehmen wollen. Ein Bild, was wir hierzu entwickelt haben, ist der des „Ermöglichungsraumes“. Der Priester bildet dabei in erster Linie die Form und einen sicheren Raum, in der Initiative entstehen kann. Das ist der eine Pol. Gleichzeitig gibt es Dinge, bei denen der Priester als Führungskraft entscheiden muss, Verantwortung trägt und für die Konsequenzen gerade steht; das bezieht sich im Übrigen auf beides: Raum halten bzw. geben ist in seiner Aktivität her mit der gleichen Verantwortung bestückt. Hierzu Erfahrungen schon während der Ausbildung zu ermöglichen – das ist eines der Anliegen des Hamburger Priesterseminars, an denen wir derzeit konzeptionell arbeiten. Weitere Pole, die wir in den Blick nehmen, ist die Innerlichkeit der Ausbildung u.a. in Bezug auf Schulung, Studium, Gebet, religiöse Praxis und die äußere Seite in Hinblick auf das soziale Leben, Gemeindeorganisation; hierzu zählen auch die angesprochenen Führungsfragen, die „weltlicheren Dinge“, die aber natürlich für die Arbeit eines Priesters genauso wichtig sind wie die intimen, religiösen Fragen. Hier den Studierenden beide Seiten als gleich wichtig zu erschließen und Ihnen in beider Hinsicht Erfahrungen zu ermöglichen, ist ein Schritt, den wir in der Ausbildung gehen wollen. Dieses soll sich in dem neuen Vollzeitstudium, welches Ende Januar 2023 starten soll, widerspiegeln. Die Ausbildung sehe ich dabei als biografische Zwischenphase, die die Grundlage für ein lebenslanges Lernen der Priester:innen bildet. Beim Erleben der Umgestaltung der Ausbildung am Priesterseminar Hamburg wächst in mir viel Hoffnung und Zutrauen für die Zukunft der Christengemeinschaft. Die Erneuerungsfreude, mit der hier vorangeschritten wird, bringt Zukunft in die Welt. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Prozess derzeit mit gestalten und voranbringen darf.
Es ist wichtig, sich das Thema „Abgeschlossenheit von Kirche“ bewusst zu machen, denn es gibt dazu immer eine Tendenz. Wir pflegen ein starkes innerliches Leben mit innerer Arbeit, und von daher braucht es eine bewusste Anstrengung und Mut zu schauen, was in der Welt lebt und was sie braucht. Das beginnt in der jeweiligen Gemeinde mit der Frage: Was will dieser Stadtteil von uns? Ich sehe für die Zukunft, dass die Christengemeinschaft mutig darauf zugeht: „Die Welt will uns!“
Wie eine strukturierte Collage
C. P.: „Was will der Stadtteil?“: Wäre das Sozialarbeit, Flüchtlingsunterkünfte oder wie sähe das aus?
E. Bolten: Das Motiv „Was will der Stadtteil?“ ist mir bei einem Besuch bei TONALi begegnet, die für ihre Studierenden bewusst mit dem Umkreis arbeiten und das Lernen der Musiker an dem Stadtteil ausrichten. Diese gehen in die Schulen im Kiez und bringen dort Projekte ins Leben. (Siehe unter „Vorschau“)
C. Bartholl: Wir haben uns schon vor mehreren Jahren im Kollegium der Volksdorfer Gemeinde darüber ausgetauscht und dafür ein Bild entwickelt: Der chilenische Architekt Aravena, Gewinner des renommierten Pritzker-Preises, hat eine Favela im Auftrag des chilenischen Staates gebaut. Er hatte nur ganz wenig Geld für eine Hauseinheit zur Verfügung. So plante er die ganze Infrastruktur dieser Favela, Plätze, Straßen, Wasser, Strom usw. und hat dann Parzellen angelegt, auf denen Häuser entstehen können. Es wurde aber nur ein Raum im ersten Stock realisiert. Dieser Raum steht auf Stelzen, in ihm gibt es ein Waschbecken mit einem Wasserausfluss. Jeder Eigentümer kann nach seinen Bedürfnissen etwas dazu bauen; die Struktur ist gelegt, aber einer hat vielleicht finanzielle Ressourcen und kann noch einen weiteren Raum dazu bauen, ein anderer macht etwas anderes daraus. Heute sieht diese Favela aus wie eine strukturierte Collage. Für uns war das ein Bild für eine ideale Gemeinde: Die Struktur wird gelegt durch die Sakramente, die wir gemeinsam pflegen. Wir stellen Räume zur Verfügung, in Volksdorf beispielsweise sind das recht viele. Es können Menschen kommen und sie für ihre Ideen nutzen. Mit einigen überlegen wir zusammen, wie ihr „Gemeinschaftsraum“ aussehen kann, für andere stellen wir die Räume einfach nur zur Verfügung. Bei uns gibt es ein Gemeindeorchester, was an die Gemeinde angebunden ist; im Laufe der Jahre haben Gemeindemitglieder weitere Initiativen ergriffen: beispielsweise wollten sie einen Chor gründen. Als 2015 die Flüchtlinge aus Syrien kamen, wollten manche Gemeindemitglieder diesen Prozess innerlich mit einer Friedensmeditation begleiten, auch durch den Ukraine-Krieg entstand eine ähnliche Frage. Es ist sehr hilfreich für den Findungsprozess, wenn Fragen entstehen. Dabei ist es ist wichtig, dass wir in eine Situation des Hörens kommen und die Bedürfnisse der Menschen erleben. Wenn man einen Fragebogen verteilen würde, kämen wahrscheinlich keine befriedigenden Antworten; die entstehen aus einer inneren Betroffenheit und aus der Wachheit, das tatsächlich auch zu hören. Wir müssen uns innerlich so öffnen, dass wir das auch mitbekommen.
E. Bolten: Genau das sind die Fragen, an denen wir im Seminar gerade dran sind! Eine Frage ist für mich dabei: wie können Freiräume entstehen, die die Menschen dann gerne ausfüllen?
C. Bartholl: Dafür gibt es zwei Bedingungen. Zum einen, dass ich bereit bin, von dem Gewohnten Abschied zu nehmen, wirklich auf den anderen zuzugehen und dabei möglicherweise das loszulassen, was mir einmal lieb geworden ist. Der Andere muss sich ernst genommen fühlen und darf nicht abgewiesen werden. Es sollte schnell etwas umgesetzt werden, das muss nicht gleich perfekt sein, aber der Betreffende soll sich einbezogen fühlen und mitmachen.
E. Bolten: Das zeigt doch wunderbar, wie durch die Bereitschaft alte Strukturen loszulassen Neues entsteht und Leben einkehrt. Der Schmerzpunkt, den Sie dabei angesprochen haben, ist wie ein kleiner Tod – ihn verwandelnd wird Neues möglich. Die „Erneuerungsfreude“ als sozusagen kultureller Habitus ist etwas, der das gut beschreibt. Da ist das individuelle Wollen jedes Einzelnen mit dabei, da kommen die Impulskräfte der Menschen zusammen.
C. Bartholl: Ich würde gerne noch auf den Kern unserer Gemeinschaftsbildung eingehen, nämlich auf die Sakramente. Es hört sich so an, als ob wir alles öffnen und uns nur orientieren nach dem, was auf uns zukommt. Aber die eigentliche Stabilität für die Gemeinschaft kommt durch die Sakramente, und die sind nicht aus der irdischen, sondern aus der geistigen Welt gestiftet. Es ist unser großes Anliegen, diesen Kultus zu pflegen und zu bewahren. Das ist auch der Grund, warum es die Christengemeinschaft schon 100 Jahre gibt: Sie hat einen Kern, auf den sich alle beziehen können und der trotzdem freilassend ist.
Wofür brauchen Menschen heute Religion?
C. P.: Meine Frage an Sie alle drei: Wofür brauchen Menschen heute Religion? Früher war es u. a. so, dass die Menschen in der irdischen Welt viel Leiden hatten und man dann von einer jenseitigen Welt einen Ausgleich erhoffte, zum Teil von den Kirchen auch versprochen bekam. Worin besteht heute eine Anbindung an das Religiöse?
F. Hörtreiter: Wir erleben täglich, dass wir funktionieren müssen, und zwar so, dass alles Individuelle in Gefahr ist, diesem Funktionieren zum Opfer zu fallen – selbst in den Beziehungen ist es so, dass wir funktionieren müssen, Bilanz ziehen, ob wir dem anderen genug zugewandt sind etc. Zu viele Forderungen werden von außen an uns gestellt. Die Frage „Wer bist du eigentlich und wohin möchtest du dich ganz persönlich entwickeln?“ spielt dabei keine Rolle. Wir sind nie als individuell Werdende gefragt. Der Wunsch nach Spiritualität, der heute eher zunimmt, trägt die Frage in sich: Wie kann ich mehr werden, als ich jetzt gerade bin? Dieses Werdenwollen hat sehr viel mit Religion zu tun. Ich muss mir klar machen: Auch der andere Mensch, nach dem ich Sehnsucht habe, hat ein höheres Wesen, als was ich bei ihm im Alltag erkenne. Da fängt die Religion an. Spiritualität allgemein könnte auch eine Art Selbstoptimierung sein. Religion beginnt erst, wo ich ein Gespräch führe mit Wesen, die mir nur zugänglich werden, wenn ich sie anspreche. Religion verlangt ein Du. Mediation kann ich in mir vollziehen. Es gibt immer mehr Menschen, die das Gefühl haben, dass sie alleine sind und ein Du brauchen. Es ist zwar so, zumindest in Nordeuropa, dass die Menschen immer zögerlicher werden, sich einer Institution anzuschließen. Die Zahl der Mitglieder der Christengemeinschaft im deutschsprachigen Raum steigt derzeit nicht, aber die Anzahl der Menschen, die sich um die Menschenweihehandlung bemühen, ist viel größer als die Zahl der Mitglieder. Das kann man nachweisen: In manchen Gemeinden gibt es mehr Beitragszahler als Mitglieder. Die Christengemeinschaft gibt den Menschen die Möglichkeit, ein Du zu finden. Diese Mischung von wiederholt erlebbarer kultischer Gemeinschaft, verbunden mit einer so radikalen Freiheit, dass jeder sagen dürfte, er glaubt das alles gar nicht und trotzdem willkommen ist. Das ist bei uns extrem, auch die Freiheit der Priester – wenn es uns nicht schon gäbe, müsste man uns dringend erfinden.
Die Selbstverpflichtung zu meiner ganz persönlichen spirituellen Praxis
E. Bolten: Das Rhythmische des Religiösen, das sich in der täglichen/wöchentlichen Gestaltung, aber auch im Jahreslauf mit seinen Festeszeiten auslebt, kann dem Menschen in seinem täglichen Tun – den Alltagszwängen zwischen Bürozeiten, E-Mails beantworten, noch kurz etwas essen bevor es in die nächste Videokonferenz geht, dann die Kinder aus der Kita abholen, zu Hause Wäsche machen, noch an die Freundin denken, mit der man schon seit zwei Monaten endlich mal wieder telefonieren wollte – eine Hilfe sein. In diesem Alltagsstrudel weiterhin Kapitän an Deck des Schiffes zu sein – hierfür kann Religion den Menschen an etwas Höheres anschließende Unterstützung sein. Faszinierend daran finde ich, dass ich dies nur selbst tun und auch nur selbst entscheiden kann. Dazu kann mich niemand anders als ich mich selbst verpflichten. Das ist doch top modern! Diese Selbstverpflichtung zu meiner ganz persönlichen spirituellen Praxis schließt mich also sowohl an etwas Höheres an, bringt mich aber zugleich auch mehr auf die Erde und stärkt meine Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit in der Welt. Friedrich Benesch beschreibt in seinem Jahreszeitenvortrag zur Sommernatur die Lebenskräftevorgänge in der Natur und bezieht sich dabei schlussendlich auf das webende, waltende Wortwesen, das dem ganzen Jahreslauf zugrunde läge. Diese Beschreibung habe ich im Hinterkopf, wenn ich davon spreche, was der Rhythmus des Jahreslaufes dem Menschen geben kann: Er kann an sich schon Religionsbildend sein und eine Ahnung vom Göttlichen erschließen. Ich als ehemalige Gärtnerin habe hier meinen ganz persönlichen religiösen Zugang, der über das Kultische in der Menschenweihehandlung nicht unbedingt hinausgeht, dies aber für mich doch ergänzt. Aber noch etwas anderes: Religion ist ja etwas Verblüffendes! Man muss es erst tun und dann kommt die Erfahrung. Wie bei Musik: erst beim Hören kann ich sie erleben. Dieser Handlungsschritt braucht einen Vertrauensvorschuss und den Mut, ins Ungewisse zu gehen. Geringer ist das nicht. Das ist wiederum etwas, was es dem modernen Mensch so schwer macht und woran er sich mit Recht stößt.
Ein Weg zur Auflösung der Trennung ist die Religion
C. Bartholl: Ich möchte noch einen weiteren Aspekt dazu stellen. Wir Menschen, die wir jetzt auf der Erde verkörpert sind, können das Gefühl haben, dass wir nicht eigentlich ganz sind, dass etwas fehlt und dass wir auch an etwas leiden. Das gehört zu unserem Sein dazu. In jedem Menschen lebt die Sehnsucht, dass wir nach einer Ganzheit streben, man könnte auch sagen: einer Einheit mit uns selbst. Diese Sehnsucht kann erfüllt werden, wenn ich das Erlebnis habe, dass die Trennung von meiner Umgebung aufgelöst wird. Ein Weg zur Auflösung der Trennung ist die Religion. Erich Fromm hat das wunderbar in seiner „Kunst des Liebens“ beschrieben, wie wir Menschen die Sehnsucht nach Vereinigung haben und dass letztlich die Liebe eine Möglichkeit bietet, eine Brücke zu schlagen. Indem ich mich auf meinen spirituellen Weg begebe, kann ich für Augenblicke erleben, mit der Welt eins zu sein. In jedem von uns, auch in der Natur, ist eine Einheit zu spüren, nämlich die des Wortes, aus dem die ganze Schöpfung heraus entstanden ist. Das ist übrigens auch ein Motiv, das uns geleitet hat, die Tagung 100 Jahre Christengemeinschaft „Logos – consecrating humanity“ zu nennen. Das, was uns eint, ist der Logos, das göttliche Wort. Wenn ich erlebe, dass in dem anderen das göttliche Wort spricht wie in mir, kann es ein Moment der Einigkeit geben. Das kann man auch in der Hinwendung zu einer Pflanze oder einem Tier erleben, wenn man sie betrachtet und erspürt, dass sich da eine Wesenheit ausspricht, die auch geprägt ist vom Logos. Wir leben in einer Welt, die immer mehr auseinander fällt, immer mehr zerstört wird, die Beziehung der Menschen zur Natur ist empfindlich gestört. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland erschüttert uns. Er ist nur einer unter vielen im Augenblick stattfindenden kriegerischen Auseinandersetzungen. Viele Menschen verlieren immer mehr den Bezug zu sich selbst – da können die Sakramente wirklich heilend wirken. Das ist gerade heute eine wichtige Aufgabe für die Religion. Die Weihe des Menschen, wie sie in dem Titel der Tagung in Dortmund „Logos – consecrating humanity“ angesprochen wird, will ihn wieder eins mich sich selbst und der Welt werden lassen, ihn auf dem Weg zum Menschheitsziel stärken.
¹Frank Hörtreiter: Die Christengemeinschaft im Nationalsozialismus. Urachhaus Verlag
Aus Anlass des 100. Jubiläums wird im Herbst 2022 die Tagung „Logos consecrating humanity“ stattfinden in Dortmund, 7.- 11. Oktober
https://cg-2022.org/wp/