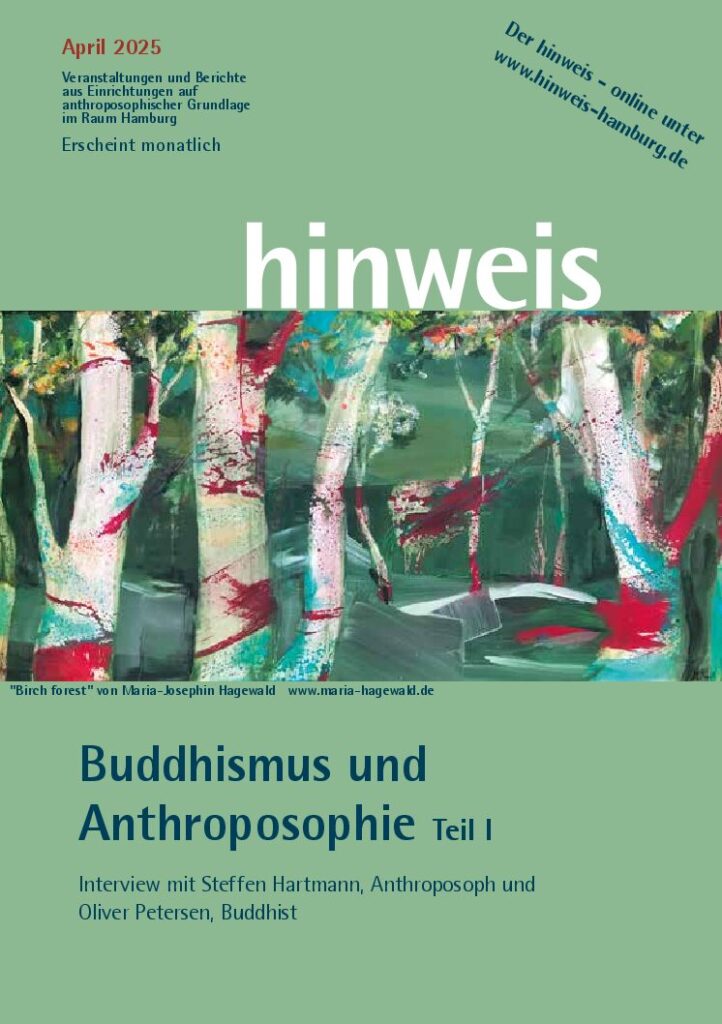Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
Was wünschen wir uns vom Gesundheitssystem?
Interview mit Dr. Stefan Schmidt-Troschke, Arzt und Christoph Kranich, Gesundheitsmanager


Eigentlich müsste das Gesundheitssystem den Patienten in den Mittelpunkt stellen und nach seinen Bedürfnissen ausrichten! Aber seit den 90er Jahren wird die Medizin immer mehr ökonomisiert und orientiert sich an den Bedürfnissen der Kostenträger und der Leistungserbringer. Es werden in Praxen und Krankenhäusern nur noch die Dienstleistungen gerne gemacht, die Geld bringen. Wir brauchen an dieser Stelle einen Systemwechsel: weg von der ökonomischen Orientierung, mehr Mitbestimmung im Gesundheitswesen, Erprobung von Modellen, die auf einer kleineren, teilweise kommunalen Ebene gemeinsam das Gesundheits- und Sozialsystem neu gestalten.
Interviewpartner:
Christoph Kranich, Diplompädagoge, Gesundheitsmanager und Krankenpfleger, ehem. Waldorfschüler, Fachabteilungsleiter Gesundheit und Patientenschutz bei der Verbraucherzentrale Hamburg seit 1995
Dr. Stefan Schmidt-Troschke, Arzt und geschäftsführender Vorstand des Bürger- und Patientenverbandes Gesundheit aktiv – Anthroposophische Heilkunst e.V. Berlin. Zuvor war er zehn Jahre medizinischer Geschäftsführer des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke.
Christine Pflug: Unser Gesundheitssystem ist in einer Schieflage. Um einige Beispiele aus der alltäglichen Praxis zu nennen: ein Patient liegt im Krankenhaus und wird vergessen zu behandeln, man kann mutmaßen aus Personalmangel. Bei Fachärzten werden in aufdringlicher Weise IGEL-Leistungen angedient, beispielsweise Testungen auf das Vorliegen von Osteoporose, grünen Star etc. ; viele Ärzten schauen während der Behandlung ausschließlich auf den Computer und nicht auf den Patienten. Es ist ein Gesundheitssystem, in dem man sich als Patient nicht mehr ausreichend gesehen, behandelt und therapiert fühlt. Das ist keine neue Erscheinung, sondern existiert schon seit einigen Jahren. Was ist der Hintergrund?
Christoph Kranich: Meiner Wahrnehmung nach hat es seit den 90er Jahren stark zugenommen, dass die Medizin ökonomisiert wurde. Das sollte eine Verbesserung mit sich bringen, aber für die Patienten ist es de facto immer schlechter geworden. Es gibt natürlich Fortschritte in der Qualität und Qualitätssicherung, d. h. in dem, was die Medizin kann usw., aber es ist nicht gelungen, die Patienten so in den Mittelpunkt zu stellen, dass sich das Gesundheitssystem an ihren Bedürfnissen ausrichtet. Es richtet sich an den Bedürfnissen der Kostenträger und der Leistungserbringer aus, also der Krankenkassen auf der einen Seite und der Ärzte und Krankenhäuser auf der anderen Seite. Die sitzen auch in allen Entscheidungsgremien, vom gemeinsamen Bundesausschuss bis auf die Landesebene. Sie gelten dort als Akteure, im Gegensatz zu den Patienten, die sind „Passeure“, also passiv. Manche privatwirtschaftlich geführte Klinik muss außerdem bis zu 10% an die Aktionäre abgeben, und dieses Geld wird aus dem Gesundheitssystem rausgeholt, bzw. eingespart.
Das Gesundheitswesen wäre die letzte Bastion einer anderen, nämlich menschlichen Denk- und Herangehensweise gewesen.
C. P.: Das Prinzip ist also ein wirtschaftliches und kein therapeutisches!?
C. Kranich: Das Schlimme ist, dass unsere ganze Gesellschaft heute nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten funktioniert. Das Gesundheitswesen wäre die letzte Bastion einer anderen, nämlich menschlichen Denk- und Herangehensweise; dass das jetzt auch noch aufgegeben wird, ist das Schlimme daran. Dann gibt es gar nichts mehr, was den Menschen auffängt.
C. P.: Ist das in den letzten Jahren immer stärker geworden?
C. Kranich: Das wird massiver, je mehr Krankenhäuser privatisiert werden und je mehr Arztpraxen sich als Unternehmen und nicht als Dienstleister für kranke Menschen verstehen. Es werden in Praxen und Krankenhäusern nur noch die Dienstleistungen gerne gemacht, die Geld bringen, bei geringen Einnahmen werden die Patienten wo anders hingeschickt, die Behandlung wird eingespart etc.
C. P.: Herr Schmidt-Troschke, haben Sie diesen Negativ-Beispielen etwas anderes hinzuzufügen?
Das, was Geld in die Kasse spült.
Stefan Schmidt-Troschke: Ich muss das leider verstärken. Wir hatten in den 80er und 90er Jahren noch einen relativen Konsens in Hinblick auf unsere Sozialsysteme, nämlich dass sie weitgehend der Daseinsfürsorge dienten; z. B. wurde im Krankenhaus auf Tagesbasis vergütet und nicht auf der Basis von Pauschalen. Aber heute haben wir einen extremen Effekt dadurch, weil die Bepreisung und die Art der Anreizsystematik im Gesundheitssystem so gestaltet ist, dass es sich lohnt, z.B. nach bestimmten technischen Untersuchungen zu schauen, die dann mehr Geld in die Kasse spülen. Und genau das passiert! In den 90er Jahren hat es einen starken Eingriff gegeben mit den ersten Kostendämpfungsgesetzen, und schließlich Anfang der 2000er mit dem Fallpauschalensystem. Bevor Chefärzte in das Zimmer des Patienten gehen, fragen sie heute als Erstes, wie lange die Verweildauer des Patienten ist, ob der Patient schon zu lange da liegt, bzw. welche Diagnostik noch gemacht werden muss, damit sich die Fallpauschale entsprechend erhöht. Das hat dazu geführt, dass sich das gesamte Medizinsystem mutiert hat. Ich glaube aber, es ist zu einfach, nur zu sagen, dass die böse Wirtschaft die Medizin kaputt macht, sondern darüber hinaus hat die Medizin einen großen Anteil an dieser Entwicklung. Durch die Quantifizierung ihrer Maßnahmen hat sie sich quasi der Wirtschaft angeboten: Man drückt alles nur quantitativ aus, den Grad von Schmerzen, den Grad von Betroffenheit, also das, was eigentlich qualitativ ist. Man hat es nicht vermocht, den Qualitäten des menschlichen Befindens einen eigenen Raum zu lassen. Das ist ein strukturelles Versagen der heutigen Medizin, was aber auch mit ihrem Menschenbild zu tun hat: Wenn ich den Menschen im Sozialsystem nur noch in Kategorien eines „Mehr oder Weniger betrachte, dann bleibt vom Menschen nur noch seine Bedeutung als Kostenfaktor übrig.
Wir müssen die Ärzte freistellen, damit sie sich um die Menschen kümmern können.
C. P.: Damit haben Sie eine Richtung angedeutet, wie man aus diesem System wieder herauskommen könnte. Christoph Kranich, wo siehst du die Drehschraube?
C. Kranich: Wenn man aus diesem System rauskommen möchte, geht das nur mit einem radikalen Wechsel. Wir müssen weg von der ökonomischen Orientierung, und wir müssen die Ärzte freistellen, damit sie sich um die Menschen kümmern können. Das heißt, sie sollen das, was sie heute verdienen, gesichert bekommen, damit sie sich nicht um Profitmaximierung kümmern müssen. Man könnte das, was durchschnittlich ein Arzt verdient – das ist bei niedergelassenen Ärzten in Deutschland monatlich mehr als 5.000 Euro netto – jedem zusichern plus die Kosten, die er für seine Geräte braucht. Das wäre quasi ein Grundeinkommen oder ein Anstellungsvertrag und die Ärzte hätten den Rücken frei, sich ordentlich um die Menschen zu kümmern.
In Ländern, wo die Ärzte angestellt sind, z. B. in Finnland, geht das. Leider sinkt dort die Motivation, habe ich mir sagen lassen; scheinbar motiviert das Geld die Menschen sehr stark, und wenige sind durch inhaltliche Ziele motivierbar. Es wäre das langfristige Ziel, dass wir in einer Gesellschaft, wo es vor allem um Leistung und Geld geht, lernen, an Inhalten und Qualitäten Interesse zu haben. Ich lebe doch nicht, um immer mehr von etwas zu haben, sondern um bestimmte Inhalte zu verwirklichen!
Weg von einem System, das ausschließlich „von oben“ organisiert wird.
S. Schmidt-Troschke: Ich würde auch sagen, dass wir an dieser Stelle einen Systemwechsel brauchen. Das Geld ist das Eine, manche Ärzte leiden tatsächlich – mehr oder weniger berechtigt – unter einem gewissen Existenzdruck. Aber in jedem Fall müssen wir weg von einem System, das ausschließlich „von oben“ organisiert wird. Neben den ökonomischen Themen haben wir im Gesundheitswesen auch ein Demokratie-Defizit, d. h. dieses System wird quasi ständisch organisiert. Das ist der Stand der Ärzte, es sind die Berufsverbände, die Krankenhäuser und die Krankenkassen; sie prägen das Gesundheitswesen und weitgehend entzogen von einem demokratischen Prozess. Mir geht es vorrangig nicht darum, dass man jetzt noch mehr Patientenvertreter mit hineinholt, sondern ich würde den demokratischen Prozess darin sehen, dass man in Gemeinden auf einer kommunalen Ebene mit den Menschen gemeinsam die Gesundheits- und Sozialsysteme neu gestaltet. Das müsste dort passieren, wo die Menschen leben; man sollte die Bürger fragen, was der Bedarf ist. Die Krankenkassen müssten ein Budget freistellen, über das Menschen in diesem Bereich verfügen können. Es gibt in manchen Bundesländern schon so etwas wie regionale Gesundheitskonferenzen, die haben meist leider nur nichts zu sagen; das Geld wird anderswo verwaltet. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Anreiz, wenn ein Arzt sich stärker Gedanken darüber machen muss, dass die Menschen in seiner Region gesund sind und nicht, dass er an möglichst vielen Kranken verdient, eine Menge bewirkt. Mein Plädoyer wäre: Nur das im Gesundheitswesen machen, was zwingend notwendig ist, basale Standards festschreiben, aber dann sehr vieles in die Verfügung der regionalen Situation geben. Das heißt, man denkt dann nicht nur darüber nach, was es kostet, einen Diabetiker zu versorgen, sondern man schaut auch, wie es dessen Frau geht, die ihn unterstützt, wie die Ernährungssituation im Stadtteil ist usw. In Hamburg gibt es einen ersten Ansatz, wie man in einem Problembezirk sehr nahe an den Menschen versucht, das System adaptiv zu gestalten: „Gesundheit für Billstedt/Horn“.
Das zeigen auch Versuche aus den USA und anderen Ländern, in denen man das probiert hat: Wo Menschen in die Gestaltung solcher Systeme einbezogen werden, gibt es ein anderes Engagement für die Gesundheit.
C. P.: Christoph, magst du erzählen von diesen Ansätzen hier in Hamburg?
C. Kranich: Da geht es darum, das, was mit dem Modell „Gesundes Kinzigtal“ im Schwarzwald bereits seit mehr als 10 Jahren erfolgreich läuft, in einer städtischen Problemregion auszuprobieren. In diesen Stadtteilen sind die gesundheitlichen Probleme besonders groß, und die Ärzte lassen sich da nicht gerne nieder. Mit einer Budget-Verantwortung und einer integrierten Versorgung, die auch präventive Aspekte stark miteinbezieht, soll dieses Modell des Kinzigtals übertragen werden. Aber es wird noch vorbereitet, ist gerade bewilligt worden und hat noch nicht gestartet. Wir werden in den nächsten Jahren eine Menge darüber erfahren.
In jedem Fall werden sie aber stärker einbezogen, indem ihnen präventive Angebote gemacht werden.
C. P.: Wie weit sind die Bürger dort einbezogen?
C. Kranich: Es ist die Frage, wie weit sie sich einbeziehen lassen, man kann sie ja nicht dazu zwingen. Es gibt aber Angebote in dieser Beziehung. In jedem Fall werden sie aber stärker einbezogen, indem ihnen präventive Angebote gemacht werden, die Ärzte vernetzen sich, es gibt gesundheitsfördernde Angebote durch Vereine, Sportvereine werden mit der ärztlichen Tätigkeit vernetzt usw. Man kann bei „Gesundes Kinzigtal“ studieren, was davon erprobt wurde. Es gibt dabei auch wirtschaftliche Anreize, das gut zu machen, weil die Region die Budgetverantwortung hat; sie bekommen das gleiche Geld wie vorher und können damit aber selber wirtschaften. Im Kinzigtal machen sie das klug und haben die Kosten für das Management, das man braucht, reingespielt und noch mehr gespart.
Gewinne, die daraus entstehen, werden in die Qualität der Versorgung investiert.
S. Schmidt-Troschke: Es ist das Gute, dass Teile der Gewinne, die daraus entstehen, in die Qualität der Versorgung investiert werden.
C. Pflug: Wie werden die Ärzte und Therapeuten finanziert?
S. Schmidt-Troschke: Im Kinzigtal ist es so, dass diejenigen, die den Vertrag unterzeichnet haben, pauschal vergütet werden; sie bekommen pro Patient eine Pauschale.
Man muss auch für diejenigen mitdenken, die unser Gesundheitssystem nicht verstehen.
C. Kranich: Man muss aber aufpassen, dass man nicht zu viel regionalisiert. Die Welt ist globalisiert, und es gibt viele Menschen, die nicht mehr einer Region zugehören, sondern Weltbürger sind. Man darf nur für die Menschen regionalisieren, die regional verankert sind. Und man muss auch für diejenigen mitdenken, die unser Gesundheitssystem nicht verstehen, also Flüchtlinge, Migranten. Das Gesundheitssystem und besonders das Medizinerlatein sind nicht für jeden verständlich. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass die Menschen nicht ihre Rechte und Obliegenheiten kennen. Eigentlich bräuchten wir ein Gesundheitssystem, das so verständlich und einfach ist, wie es mal ein Politiker für das Finanzsystem forderte: Es soll auf einen Bierdeckel passen.
S. Schmidt-Troschke: Eine Sache aus Hamburg kann ich noch dazustellen, weil ich gerade mit Helmut Hildebrandt, der das Hamburger Modell federführend realisiert, gesprochen habe. Es wird einen Gesundheitskiosk geben; jeder Bürger kann kommen, egal welcher Sprache er mächtig ist und kann dort Informationen und Zugang zur Versorgung finden. Es ist eine sehr niedrigschwellige Form, sich mit dem Gesundheitswesen vertraut zu machen.
Ein Aspekt ist mir auch noch wichtig: Wir haben auf der einen Seite ein tolles Sozialversicherungssystem, alle geben etwas rein und derjenige, der es braucht, kann davon abschöpfen. Das ist ein großer Segen, den wir seit Bismarck haben. Aber der Solidaritätsgesichtspunkt ist nicht individualisiert, und ich würde mir wünschen, dass wir innerhalb der Sozialversicherungssysteme im 21. Jahrhundert überlegen, wie man zumindest Teile der Sozialversicherung den Versicherten zugänglich macht und dass man damit experimentiert. Vielleicht könnte es innerhalb der großen Solidargemeinschaft kleine Solidargemeinschaften geben; wie kann man Wahloptionen für solche Modelle schaffen, wie für Pluralität sorgen…? In unserer globalisierten Gesellschaft gibt es unterschiedliche Prioritäten hinsichtlich der Gesundheit – wie kann man das in dem Sozialversicherungssystem abbilden, und zwar so, dass es ein System ist, in dem es nicht nur „von oben runter regnet“, sondern das auch von unten mitentwickelt und geprägt werden kann?
Nicht mit Ansprüchen, sondern mit Zuspruch arbeiten.
C. P.: Wären das Solidargemeinschaften, wie z. B. Artabana oder Samarita, die eine solidarische Krankenversicherung nochmal neu zu entwickeln versuchen (Siehe Seite 12)?
S. Schmidt-Troschke: Solche spannenden Modelle sind Entwicklungsorte für Prototypen. Gesamtgesellschaftlich müsste man schauen, welche Anpassungen es braucht, um sie breiter umzusetzen. Ich fände es interessant, innerhalb der großen Sozialversicherung zu überlegen, wie sich mehr wirkliche Mitbestimmung realisieren ließe. Ich würde davon ausgehen, dass die Versicherten nicht immer eigennützig handeln und dass man mehr den Vertrauensgesichtspunkt entwickelt. Es gibt spannende Ansätze, z. B. von den Hannoverschen Kassen, die mit tausend Menschen ein System aufbauen, in dem sie nicht mit Ansprüchen sondern, mit Zuspruch arbeiten. Es hat sich gezeigt, dass die Menschen sehr vorsichtig damit umgehen, was sie für sich haben wollen und aufeinander Rücksicht nehmen.
Es wird nicht funktionieren, dass man das gesamte System von jetzt an gleich kippt. Man wird aber Öffnungsmöglichkeiten schaffen können, in denen man erprobt, wie man die Versicherten stärker mitgestaltend einbinden kann.
C. P.: Christoph, hast du Ansätze für erste Schritte?
C. Kranich: Solche Modelle, wie Stefan Schmidt-Troschke angesprochen hat, sind für elitäre Gruppen, die das Bewusstsein für Solidarität aufbringen und sich das leisten können, weil sie nicht pflichtversichert sind. Ich kenne viele Menschen, die diese Art von individualisierter Solidarität gar nicht ausüben könnten, die große Hemmungen haben, sich von der Krankenkasse Geld für eine Behandlung geben zu lassen, weil sie meinen, sie hätten nicht genug einbezahlt. Solidarität haben wir heute überhaupt nicht im Bewusstsein, denn das bedeutet, dass der, der kann, bezahlt für den, der nicht kann. Das Prinzip, was wir heute kennen, heißt dagegen „Auge um Auge, Zahn um Zahn“: Nur wenn du einbezahlt hast, darfst du auch was rausholen. Ich bekomme nur so viel Rente, wie ich eingezahlt habe, und auf der Sparkasse bekomme ich so viel Zinsen, wie ich angelegt habe. Wer wenig Einkommen hat, muss dort sogar noch Kontoführungsgebühren bezahlen; Reiche nicht. Solidarität hat eigentlich mit der bedingungslosen Solidarität zu tun: Wenn ich krank bin, bekomme ich das, was ich brauche.
C. P.: Das ist doch im Gesundheitswesen der Fall?
C. Kranich: Ja, aber es ist schwer, das auf eine individuelle Ebene herunter zu brechen, weil es die Menschen hindert, jenseits davon zu kommunizieren. Wenn ich weiß “du gibst mir von deinem Geld ab, weil ich krank bin“, bin ich dir gegenüber nicht mehr frei im menschlichen Kontakt. Deshalb ist es gut, dass ich nicht weiß, wer mich bezahlt, wenn ich krank bin, das würde die Kommunikation stark belasten. Das ist das schwierige daran. Ich bin sehr für solche Experimente und habe beobachtet, was Artabana und Samarita machen, war auch in den 90er Jahren an einer Krankenkasse beteiligt, die sich stark für eine Einbindung ihrer Mitglieder eingesetzt hat. Ich habe aber gemerkt, dass die meisten Menschen das eigentlich nicht wollen; sie wollen es anonym halten und sich nicht kennen.
S. Schmidt-Troschke: Wenn wir uns auf einer Systembasis bewegen, kann es sich nicht darum handeln, zu überlegen, wie ich meinem Nachbarn das gebrochene Bein finanziere. Wenn man allerdings die Gruppen, um die es geht, etwas kleiner hält als bisher kann man beispielsweise sagen: Wir haben im Stadtteil dieses oder jenes Problem, wir haben eine bestimmte Summe an Einnahmen – wie können wir uns damit gegenseitig unterstützen? Ich würde dafür plädieren, dass man immer wieder Erprobungen macht und versucht, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, dass man stärker ein regionales Bewusstsein fordert. Das wird nicht von jetzt auf nachher gelöst, aber ich würde mir Entwicklungsräume wünschen.
Die Wirtschaft müsste das Vorbild für Solidarität werden, dann ist das Gesundheitswesen auch dabei.
C. Kranich: Man muss auch schauen, wie wir den Menschen, die nachkommen, frühzeitig das Solidaritätsbewusstsein einprägen. In der Schule lernt man darüber nichts; es gehört in die Sozialkunde. Es darf nicht dabei bleiben, dass nur das Gesundheitssystem Solidarität aufweist und alle anderen Systeme nicht. Eigentlich gehört die Solidarität ins Wirtschaftsleben, und da wird sie fast gar nicht gelebt. Sie wird bestenfalls heimlich gelebt, weil jeder für andere produziert, aber bewusstseinsmäßig denkt jeder nur an sich. Die Wirtschaft müsste das Vorbild für Solidarität werden, dann ist das Gesundheitswesen auch dabei. Deswegen ist das Problem nicht im Gesundheitswesen zu lösen, sondern man muss die Wirtschaft neu strukturieren.
Alle Informationen über das „Gesunde Kinzigtal“www.gesundes-kinzigtal.de
Informationen über das Projekt „Gesundheit für Billstedt/Horn“:
www.gesundheit-billstedt-horn.de
www.optimedis.de/netzwerke/gesundheit-fuer-billstedt-horn