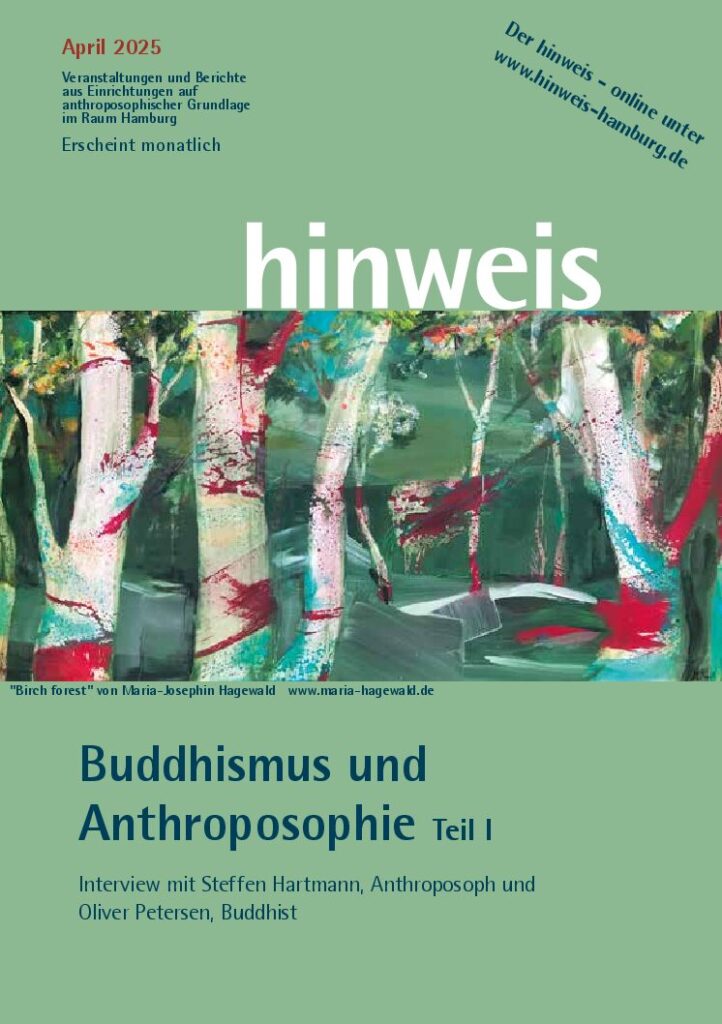Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
Die Zukunft der Arbeit
Interview mit Lars Grünewald

„Jede Persönlichkeit repräsentiert eine geistige Potenz, eine Summe von Kräften, die nach der Möglickeit zu wirken suchen.
Jedermann muss deshalb den Platz finden, wo sich sein Wirken in der
zweckmäßigsten Weise in seinen Volksorganismus eingliedern kann.
Es darf nicht dem Zufalle überlassen bleiben, ob er diesen Platz findet. Die Staatsverfassung hat keinen anderen Zweck, als dafür zu sorgen, dass jeder einen angemessenen Wirkungskreis findet“ (Rudolf Steiner GA 1, tb S. 209).
Arbeit wurde früher von Menschen geleistet. Heute sind es immer mehr die Maschinen, die die Produkte herstellen. Dadurch ist der Mensch frei gestellt: Er könnte nun das arbeiten, was nicht von Maschinen geleistet werden kann, d. h. kreative und individuelle Tätigkeit. Aber um das für die ganze Gesellschaft umzusetzen, bedarf es eines fundamentalen Umdenkens und grundlegender Umstrukturierungen. Wie könnte in solch einem neuen System die Finanzierung aussehen? Wie können Menschen lernen, kreativ und produktiv zu arbeiten? Wenn ein zukünftiges Arbeitsleben vorwiegend Projektcharakter hat, welche Ausbildungen braucht man dann?
Interviewpartner: Lars Grünewald, geb. 1962, Studium der Musikwissenschaften und Erziehungswissenschaften, danach autodidaktisches Philosophiestudium mit den Schwerpunkten Deutscher Idealismus und Anthroposophie. „Mich interessierte besonders die Verknüpfung des reinen Denkens der Philosophie mit der Praxis der grundlegenden sozialen Probleme, die wir heute in unserer Gesellschaft haben. Auf dieser Basis habe ich versucht, eine Art von Selbständigkeit zu begründen, was nach einer längeren Vorlaufzeit in den letzten fünf, sechs Jahren recht gut funktioniert.“
Er ist tätig in der Erwachsenenbildung mit Seminaren und Vorträgen, z. B. zu den Themen Arbeit, Erziehung, Einführung in das reine Denken (Hegels „Wissenschaft der Logik“), zwischenmenschliche Beziehungen, Astrologie etc.); in Hamburg hauptsächlich in der Forum-Initiative. In letzter Zeit ist er auch in der Schule in projektbezogener Arbeit mit Schülern tätig.
Christine Pflug: Was ist Arbeit?
Lars Grünewald: Arbeit ist immer Tätigkeit mit dem Ziel der Bedürfnisbefriedigung. Das können die eigenen Bedürfnisse sein – das klassische Selbstversorgerprinzip – oder auch die der anderen. Das gilt für vergangene Zeiten wie für heutige. Unterschiedlich sind nur die Arten der Bedürfnisse und die Mittel, diese zu befriedigen. In der Vergangenheit bezogen sich die durch Arbeit befriedigten Bedürfnisse vorwiegend auf das Leibliche des Menschen; und gerade dieser Bereich wird heute immer mehr durch maschinelle Arbeit übernommen.
reproduktive und produktive Arbeit
C. P.: Diese leiblichen Bedürfnisse sind beispielsweise Ernährung. Wie weit wird das von Maschinen übernommen?
L. Grünewald: Das Prinzip der maschinellen Arbeit ist die geregelte Reproduktion, nämlich dass man auf eine eindeutige Eingabe (eine Anweisung) eine eindeutige Ausgabe (ein Resultat) bekommt. Mit anderen Worten: Alles, was an Dienstleistungen auf Reproduktion basiert, geht immer mehr in den maschinellen Bereich über; alles, was auf individueller Anfertigung beruht, ist der Bereich, der für die menschliche Betätigung bleibt. Einmaligkeit setzt Produktivität voraus, bei der man zu gewissen Teilen erst als unmittelbare Reaktion bestimmen kann, welche Art von Bedürfnisbefriedigung zu dem jeweiligen Bedürfnis passt.
Bei der Ernährung gibt es einerseits einen Bereich, der auf „Sonderanfertigung“ beruht, aber natürlich auch den der massenhaften Reproduktion, der damit die flächendeckende Versorgung in großer Stückzahl ermöglicht, und das – zumindest theoretisch – zu günstigen Preisen, weil die Herstellungskosten gering sind.
C. P.: Wie gestaltete sich Arbeit früher und wie heute?
L. Grünewald: Die Fließbandarbeit wurde früher betrieben, um die Vorteile mechanischer Arbeit zu ermöglichen, aber der Mensch war derjenige, der diese Arbeit selber erledigen musste und dadurch in ganz starkem Maße durch reproduktive Tätigkeit gebunden war. Die forderte keinerlei Initiative oder Kreativität. Das war ein Durchgangsstadium vom Beginn der Industrialisierung an. Jetzt haben wir aber immer mehr Maschinen, die dem Menschen das abnehmen. Dadurch wird die menschliche Arbeitskraft frei für andere, spezifisch menschliche Arbeit, nämlich nicht mehr für reproduktive, sondern für produktive Tätigkeit.
C. P.: Theoretisch …?
L. Grünewald: Nein, auch praktisch. Das sieht man an den Arbeitslosenzahlen, die ja nichts anderes als den Ausdruck der Freiheit von reproduktiver Arbeit bilden. Wir haben aber noch keine wirkungsvollen Organisationsformen gefunden, die die Freiheit von der reproduktiven Arbeit dahin überführen können, dass produktive Arbeit so geleistet werden kann, dass die Menschen davon leben können, d. h. damit Geld verdienen. Damit ist nicht die Gestaltung der Freizeit gemeint, sondern dass das, was der einzelne Mensch arbeitet, anderen Menschen zugutekommt.
Natürlich gibt es auch heute schon einige Initiativen, die das Ziel haben, die Kräfte zu bündeln und neue Formen der Selbstorganisation zu finden, die es ermöglicht, effizient zu arbeiten und solche Menschen zusammenzubringen, die gemeinsam anspruchsvollere Aufgaben bewältigen können.
Entdecken wir Bedürfnisse, die kreative und produktive Arbeit erforderlich machen?
C. P.: Wenn ein Großteil der Bedürfnisse durch reproduktive Arbeit abgedeckt wird, welche Arbeit bleibt dann überhaupt noch übrig?
Lars Grünewald: Wenn Arbeit Bedürfnisbefriedigung ist, dann hängt dasjenige, was an Arbeit erforderlich ist, davon ab, welche Bedürfnisse vorhanden sind und wie sie geäußert werden. Denn es nützt nichts, wenn jemand ein Bedürfnis hat und ich für ihn arbeiten soll oder möchte, wenn ich nicht weiß, was das für ein Bedürfnis ist. Das ist zunächst ein Selbstreflexions- und dann ein Kommunikationsproblem, nämlich das eigene Bedürfnis durch Selbstbefragung zu ermitteln und es dann mitzuteilen.
Nun ist die Frage: Haben wir nur Bedürfnisse, die reproduktiv sind, sich also ständig wiederholen, so dass sie auch durch reproduktive Arbeit befriedigt werden können? Oder entdecken wir Bedürfnisse, die uns jetzt vielleicht noch gar nicht bewusst sind und die darauf hinauslaufen, dass sie zu ihrer Befriedigung kreative und produktive Arbeit erforderlich machen? Das halte ich für eine Schlüsselfrage.
C. P.: Beides ist ja vorhanden. Meinen Sie, dass die Bedürfnisse, die von kreativer Arbeit befriedigt werden können, noch mehr entdeckt werden müssten?
L. Grünewald: Ganz erheblich. Wie bei allen Phänomenen gehören auch zum Bedürfnis zwei Ebenen: die der Wahrnehmungen und die der Begriffe. Wenn ich ein Bedürfnis empfinde, aber es nicht benennen kann, bleibt es in gewissem Sinne unbewusst, und vor allem kann ich es nicht kommunizieren.
Je mehr sich die Bedürfnisse in eine kulturelle und geistige Richtung bewegen, desto mehr individualisieren sie sich. Je mehr sie dagegen in eine mehr auf das Leibliche orientierte Richtung gehen, desto mehr generalisieren und normieren sie sich.
C. P.: Sind die Bedürfnisse, die durch reproduzierbare Arbeit befriedigt werden, im Allgemeinen bekannt? Eigentlich werden sie ja sogar durch die Werbung erst hervorgerufen!?
L. Grünewald: Bei vielem, was angeboten wird, wird gar nicht davon ausgegangen, dass die Bedürfnisse vorhanden sind, sondern man versucht, den Bedarf zu erzeugen – durch Werbung.
Der Ursprung des Wirtschaftslebens, von realen Bedürfnissen auszugehen, ist im Laufe der Zeit weitgehend vergessen worden. Es werden zuerst Unternehmen gegründet mit dem Ziel des Erwerbs, und dann fragt man sich, welche Bedürfnisse man damit bedienen kann. Und wenn die noch gar nicht da sind, versucht man sie zu erwecken. Das ist ein im hohen Grade manipulatives Vorgehen.
C. P.: Wir würden doch aber fast alle sagen, dass wir ein Auto brauchen…
L. Grünewald: Das ja. Aber was für eines? Welche Extras brauchen wir, welche Ausstattung, welche Größe usw.? Oder brauchen wir wirklich ein Handy, das fotografieren kann, Internetzugang hat usw.? Für die Technik stellt sich immer die Frage „Was ist realisierbar?“, während vom Menschen her gesehen die Frage wäre, was wirklich sein Bedürfnis ist.
C. P.: Sie sagen, dass in dem produktiven Bereich der Arbeit noch viel Potential liegt. Haben Sie einige Beispiele, in welche Richtung das gehen könnte?
L. Grünewald: Ich kann ein Beispiel nennen aus dem Bereich des schulischen Lebens. Da haben wir im Bereich des Stundenplans und der Regelfächer das Prinzip der Reproduktion. Wir haben diese „Schubladen“, und die muss man so organisieren, dass sich ein abstraktes Gerüst – genannt Stundenplan – ergibt, das sich durch die Schuljahre hindurch zieht. Zu einem immer größeren Teil sitzen die Schüler vor Computern, und auch seitens der Politik gibt es Vorgaben, die Lehrpläne so durchzustrukturieren, dass die Inhalte immer mehr festgelegt sind. Und je mehr das der Fall ist, desto mehr können sie durch ebenso festgelegte, auf Reproduzierbarkeit hin angelegte Bildungsangebote bedient werden. Und natürlich gibt es bereits Firmen, die für solche Bildungsangebote Computerprogramme herstellen den Schulen anbieten.
Wirkliche produktive Arbeit in Schulen hätte Projektcharakter. Ein Projekt ist ein Themenschwerpunkt, der auch klassenübergreifend sein kann, und man verabredet sich für eine gewisse Zeit, um dieses Thema zu bearbeiten. Das kann zunächst außerhalb des regulären Stundenplans stattfinden. Die schöpferische Arbeit beginnt schon damit, dass es keine vorgegebenen „Rituale“ gibt, sondern eine Projektgruppe sich eigene Arbeitsformen entwickelt, mit denen auch experimentiert wird. Die Gestaltung der Form gehört hier zum kreativen Prozess. Alles basiert auf Verabredungen.
Die nächste Frage ist, wie sich so ein am Rande des schulischen Lebens angesiedeltes Projekt in den Schulorganismus integrieren lässt. Das wird aber nur gelingen, wenn sich die bisherigen Strukturen auch aufweichen und eine Wechselwirkung zwischen projekthafter und reproduktiver Arbeit (d.h. Regelunterricht) entsteht.
Projektarbeit hat immer eine spezifische Themenformulierung und wirkt individualisierend, während ein Fach immer auf Generalisierung (Verallgemeinerung) beruht. In der Individualisierung der Inhalte sehe ich den entscheidenden Schritt, in der Unterrichtsgestaltung von der Ebene der Verstandesseele zu der der Bewusstseinsseele zu kommen.
C. P.: Welche Themen werden beispielsweise bearbeitet?
L. Grünewald: Ein Thema war „Alte und neue Lebensformen“; mein Einstiegsthema war „Zukunft der Arbeit“. Dieses Thema ist für die Schüler kurz vor dem Schulabschluss natürlich von besonderer Bedeutung.
ein Projekt ist von vornherein darauf angelegt, nur eine gewisse Lebensphase auszufüllen
C. P.: In welchen anderen Bereichen außer dem Schulbetrieb findet noch so eine produktive Arbeit statt?
L. Grünewald: Wir finden das heute schon häufig in künstlerischen Bereichen. Wir kommen allmählich weg davon, dass es bestimmte Orte gibt, Opernhäuser, Konzerthallen, an denen gewisse Kunstformen fortwährend reproduziert werden. Es entsteht immer mehr Projektarbeit; und Teams werden zusammengestellt, die keine Festverträge haben, um damit bis auf weiteres an einer Institution zu arbeiten, sondern es kristallisiert sich eine projektgebundene Arbeitsgemeinschaft um einen Kreis von Initiatoren. Sie arbeiten so lange an einem Projekt, bis es fertig ist und danach werden die Karten gewissermaßen neu gemischt. D. h. ein Projekt ist von vornherein darauf angelegt, nur eine gewisse Lebensphase auszufüllen, die allerdings – z.B. bei Forschungsprojekten – u.U. sehr lang sein kann. Wichtig ist darauf zu achten, wieviel Zeit ein Projekt tatsächlich erfordert, damit sich die Arbeit nicht als Beruf abkoppelt von dem, was gerade anliegt und sich dann, wie Goethe es vom Gesetz sagt, wie eine alte Erbkrankheit fortpflanzt.
C. P.: Für solche Bereiche wie Schule und Kunst kann man das gut nachvollziehen. Aber wie sieht es aus bei der Autoherstellung, Bäckerei, Gärtnerei usw.?
L. Grünewald: Das sind genau die Bereiche, wo man unterscheiden muss, ob es ein hinreichend generalisiertes Bedürfnis gibt, für das man die Produkte in Serie herstellen lässt. Das ist dann ein Bereich, den man effizient durch maschinelle Arbeit abdecken kann, d. h. man muss niemandem zumuten, mit solch einer reproduktiven Arbeit sein Leben zu verbringen.
Wenn nun aber z. B. in einer Bäckerei Sonderwünsche für bestimmte Produkte da sind, die man individuell anfertigen muss und bei denen sich eine maschinelle Herstellung nicht lohnt, dann stellt sich die Frage: Kann ich – aus Kundensicht – jemanden so motivieren, dass er diese Sonderwünsche befriedigt? Es muss sich für diesen Menschen natürlich auch finanziell lohnen.
C. P.: Das kennt man beispielsweise von der Entscheidung, ob man Möbel von einer computergesteuerten Herstellung kauft oder ob man sich einen Schreiner leisten möchte.
L. Grünewald: Ein Schreiner kann heute nur noch so lange seine Tätigkeit ausüben, wie er individualisierte Bedürfnisse vorfindet. Die normierten Bedürfnisse kann er nämlich nicht zu konkurrenzfähigen Preisen bedienen.
C. P.: Heißt das, dass in Zukunft alle Menschen eine kreative Arbeit ausüben können?
80% wäre dann die zu erwartende Arbeitslosenquote
L. Grünewald: Der Veranlagung nach ja. Biografisch ergeben sich graduelle Unterschiede. Sicherlich wird man kaum sagen können, dass jemand, der überhaupt arbeitsfähig ist, gar nicht in der Lage wäre, kreativ zu sein. Diese Auffassung käme aus einem falschen Menschenbild. In der Realität sind aber Unterschiede vorhanden. Da passt es dann gar nicht schlecht, dass – nach US-amerikanischen Hochrechnungen – in Zukunft ca. 20% der Bevölkerung für reproduktive Arbeiten gebraucht werden. 80% wäre dann die zu erwartende Arbeitslosenquote, wenn nur noch reproduktiv gearbeitet werden würde, bzw. wenn die produktive Arbeit nur dafür eingesetzt würde, die reproduktive zu organisieren, d. h. Programme zu entwickeln, die Maschinen zu beaufsichtigen, den Vertrieb zu organisieren usw.
C. P.: Es ergibt sich damit ja die Frage, womit die restlichen 80% der Bevölkerung ohne Arbeit finanziert werden sollen?
L. Grünewald: Wenn man den Gegensatz von reproduktiver und produktiver Arbeit zu Ende denkt, zeigt sich, dass wir zwei Systeme bekämen: das der reproduktiven Arbeit, bei der mit geringem Aufwand große Erträge erwirtschaftet werden, und dasjenige der produktiven Arbeit, wo mit viel Aufwand geringe Erträge erwirtschaftet werden. Es würde also die Aufgabe sein, die finanziellen Überschüsse, die das eine System bringt, auf eine organisierte Weise in das andere System überzuleiten.
Insofern kommen wir um gesetzliche Änderungen nicht herum
C. P.: Das ist theoretisch richtig. Aber wie kann das geschehen?
L. Grünewald: Das kann letzten Endes nur durch entsprechende Gesetze geschehen, die in unserem Staat früher oder später sowieso geändert werden müssen. An grundlegenden Änderungen der Struktur unseres Wirtschaftssystems kommen wir nicht vorbei. Die Frage ist lediglich, wie weit man das jetzige Schiff noch weiter untergehen lässt. Es ist ja schon beständig am Sinken. Die ganzen Finanzmärkte, so wissen wir aus den Medien, sind real schon krepiert und werden nur noch durch künstliche Maßnahmen – reine Verabredungen – am Leben erhalten. Und das wird nicht ewig gut gehen. Insofern kommen wir um diese gesetzlichen Änderungen nicht herum. Man muss einsehen, und das ist zum Teil auch schon passiert, dass in dem jetzigen System der erwerbswirtschaftlichen Orientierung einige wenige, die die Verfügungsgewalt über die Maschinen und die Beschäftigten haben, gigantische Gewinne erwirtschaften und gewissermaßen eine neue „Herrenrasse“ – eine Art von Besitz- und Machtadel – bilden.
C. P.: Man würde dann beispielsweise durch Steuern Gelder aus dem reproduktiven Bereich herausziehen und in neu zu gründende produktive Bereiche fließen lassen. Was könnte beispielsweise so ein neuer Bereich sein?
Gelder aus dem reproduktiven Bereich herausziehen
L. Grünewald: Das, was gegründet wird, hängt von denen ab, die es gründen wollen. Und ob eine Gründung erfolgreich ist, hängt davon ab, ob sie real vorhandene Bedürfnisse befriedigt.
Aufgabe des Staates ist es lediglich zu überwachen, dass diese Transaktion stattfindet und dem kulturellen Betrieb zugute kommt, nicht aber darüber zu entscheiden, was mit diesem Geld gemacht wird. Es ist nicht die Aufgabe des Staates, Geistesleben zu organisieren.
Hier ist vielmehr die Frage, wie sich die Bedürfnisse äußern und wie die produktiven Bereiche der Gesellschaft miteinander in Kommunikation treten. Man könnte einen Modus finden, an dem Zuspruch, den ein Projekt bekommt, auch dessen finanzielle Unterstützung zu orientieren. Die Gremien der kulturschaffenden Kräfte können an der Beteiligung ablesen, wie groß das Interesse an einer Dienstleistung ist und von daher entscheiden, in welchem Maße ein Projekt bezuschusst wird. Dann hätte man eine Wirtschaftsgröße und keine geistige Größe als Orientierung.
C. P.: Dieses Modell der produktiven Arbeit ist ja auf die Zukunft ausgerichtet. Derzeit wären wahrscheinlich die meisten Menschen überfordert, in solche Prozesse einzusteigen. Was müsste geschehen, damit diese 80% der Bevölkerung motiviert und fähig sind, ihre Arbeitskraft auch wirklich in eine schöpferische Tätigkeit hinein zu geben?
L. Grünewald: Das kann man auf unterschiedlichen Ebenen anregen. Es beginnt bei der Erziehung der Eltern: Wie regt man bei den Kindern Kreativität an? Ab einem relativ frühen Alter können Eltern die Selbstorganisation fördern: „Kaufe dir das nicht einfach, sondern versuche es selber, oder mit anderen zusammen, zu basteln oder zu organisieren.“
Die zweite Ebene wäre die Schule. Je mehr es in Richtung Oberstufe geht, ist es sinnvoll, das dahinter stehende Konzept der Projektarbeit auch wirklich in Begriffsform als Unterrichtsthema zu behandeln, damit deutlich wird: „Das, was vor dir liegt, ist deine eigene Arbeitsbiografie, und wir können dir lediglich die Mittel in die Hand geben, diese Biografie in deinem Sinne zu gestalten. Wir liefern dir Erkenntnisbegriffe, aber keine Handlungsanweisungen; du musst selbst die Verantwortung für die Gestaltung deines Arbeitslebens übernehmen.“
Die nächste Ebene ist die der Berufsausbildung. Hier gibt es einen Bedarf an grundlegend neuen Strukturen. Von dem griechisch-römischen Ideal, dass man etwas „zu Ende“ studiert, bevor man in die Praxis geht, kommen wir langsam schon ab. Die Frage ist: Was willst du als nächstes machen und welches Wissen und Können ist dafür erforderlich? Natürlich muss man mit einem bestimmten Startwissen eine Arbeit antreten; aber die eigentlich entscheidenden – nämlich unmittelbar auf die Praxis bezogenen Lernprozesse – finden während der Arbeit statt.
Da, wo die Menschen aus der Arbeit entlassen wurden, ist die entscheidende Frage, was auf der Bewusstseinsebene passiert: Kommen sie zur Idee einer organisatorischen Trennung der Arbeit vom Einkommen? „Ich habe eigentlich zwei Probleme: wie ernähre ich mich und was arbeite ich produktiv?“ So lange man noch denkt: „Ich fange erst wieder an zu arbeiten, wenn ich einen Arbeitgeber habe“, ist das Schiff nicht aus dem Sumpf zu bekommen. Da ist ein versteckter und auch angelernter Egoismus dahinter, mit dem sich die Menschen selbst ein Bein stellen.
C. P.: Das sind aber massive Umdenkungs- und Umfühlungsprozesse, weil mit Arbeitslosigkeit ein Makel verbunden ist.
L. Grünewald: Bis man sich zu dem Punkt vorarbeitet, an dem auf gesellschaftlicher Ebene ein Wandel der Sichtweisen wirklich eintreten kann – das dauert manchmal Jahre. Aber zunächst kommt es nur darauf an, ob es dem Einzelnen gelingt, den Blick zu wechseln. Es ist das Prinzip der Bewusstseinsseele, die Änderung der Situation nicht mehr – wie bei der Verstandesseele – durch eine Änderung der äußeren Sachverhalte, sondern durch die Änderung des Blickwinkels zu ermöglichen.
C. P.: Sie haben bereits angedeutet, dass die zukünftige Arbeit vorwiegend Projektarbeit sein wird. Andererseits muss es ja bestimmte Berufsausbildungen geben – man möchte sich ja nicht von jemand als Projekt mal sein Bein operieren lassen. Wie ist das zu sehen?
L. Grünewald: Es geht nicht darum, die alten Formen dort, wo sie berechtigt sind, „auszurotten“. Es gibt – etwa im Gesundheitswesen oder im Rechtsleben – solche Arten von Tätigkeiten, die eine sehr umfangreiche Ausbildung erfordern; und es ist deshalb auch gerechtfertigt, dass sie über einen entsprechend langen Zeitraum, also in Form eines herkömmlichen Berufes, ausgeübt werden. Sonst lohnt sich die Ausbildung nicht. Es kommt nur darauf an, die Dauer der Ausbildung und diejenige der Berufsausübung in ein angemessenes Verhältnis zu setzen.
C. Pflug: Wie sollen diejenigen, die in Projekten arbeiten, ausgebildet werden?
L. Grünewald: Das hängt von den Projekten ab – von deren Charakter lassen sich die dazu erforderlichen Fähigkeiten ableiten.
Nun ist es ja so, dass viele Projekte bei konventionellen Tätigkeiten ansetzen. Das Neue entsteht nicht aus dem Nichts, sondern knüpft an das Alte an. Beispielsweise kann jemand seine bisherige Berufstätigkeit auf halbtags beschränken und mit der anderen Hälfte in seine Projektarbeit Fähigkeiten hineinbringen, die er sich in seinem Berufsleben erworben hat.
Oder jemand könnte für sich Schwerpunkte setzen, beispielsweise eine Ausbildung als Tontechniker machen und könnte danach für Projekte zur Verfügung stehen, in denen diese Fertigkeiten gebraucht werden. Wenn man völlig unspezialisiert bleibt, besteht die Gefahr, dass man keine qualifizierten Leistungen vollbringen kann.
Bezüglich des Verdienstes könnte es so sein, dass derjenige in seinem bisherigen Beruf viel Geld bekommt und dann in der Projektarbeit weniger verdienen muss. Dadurch zieht er das Geld aus dem alten System heraus und gibt es in das neue hinein, indem seine Berufstätigkeit die Projektarbeit finanziert. Projektarbeit hat aber prinzipiell Wachstumschancen und wird in Zukunft lukrativer werden.
C. P.: Was Sie beschreiben, sind bereits die Übergänge in diese neuen Verhältnisse …
L. Grünewald: Und diese Übergänge sind immer konkret und individuell. Das, was mich an das Alte bindet, ist geisteswissenschaftlich ausgedrückt Karma. Da, wo ich in einem Strom bin, den ich nicht unmittelbar selber entwerfe, handelt es sich um den Vergangenheitsstrom. Steiner führt Goethe als ein Beispiel des modernen Bewusstseinsseelenmenschen an, der ausschließlich Projektarbeit gemacht hat. Seine Projekte waren Dichter zu sein, Wissenschaftler, Politiker etc..
C. P.: Wie könnte man sich Übergänge vorstellen, dass das Geld von der reproduktiven Arbeit in die produktive fließt? Und wie kann man vermeiden, dass dann die Unternehmer ins Ausland abhauen?
L. Grünewald: Sollen sie gehen. Wer weggeht, eröffnet Kapazitäten für Nachwuchs. Natürlich ist das mit einem zeitweiligen Rückgehen des äußeren Lebensstandards verbunden, wenn die Marktführer ihre Produkte nicht mehr zu den derzeitigen Preisen absetzen könnten, weil sie ihr Geld ins Ausland nehmen und deswegen ihre Produkte als Importe entsprechend besteuert würden.
Nur: wenn wir so weitermachen wie bisher, wird das auf noch viel dramatischere Weise der Fall sein. So schlimm wie etwa nach dem zweiten Weltkrieg müsste es jetzt noch nicht werden. Ob man das in 10 Jahren immer noch sagen kann, bleibe dahin gestellt.
C. P.: Man müsste also neue Gesetze einführen?
L. Grünewald: Mittelfristig auf jeden Fall. Kurzfristig ist es erstaunlich, welchen Ertrag man erwirtschaften kann ohne derartige Unterstützung. Ich erlebe es selbst, dass Menschen bereit sind, in einem solidarischen Finanzierungssystem einiges aufzubringen. Diejenigen, die mehr haben, bittet man mehr zu zahlen, damit andere, die wenig oder nichts haben, nicht ausgeschlossen werden. Wenn ich beispielsweise mit knapp kalkulierten Festpreisen arbeite, sage ich immer, dass eine hinreichende Finanzierung nötig ist, und es zeigt sich, dass Menschen, die mehr haben, auf mich zukommen und bereit sind, mehr zu geben. Ich habe dabei gemerkt, dass mehr Moralität in den Menschen steckt, wenn man sie sich entfalten lässt, d. h. wenn man deutlich macht: Wir tragen gemeinsam die Verantwortung dafür, dass hier etwas stattfinden kann.
Da kann man im Moment noch einiges organisieren ohne staatliche Hilfe, aber längerfristig kommen wir um eine Umverteilung nicht herum.
Mail-Adresse: