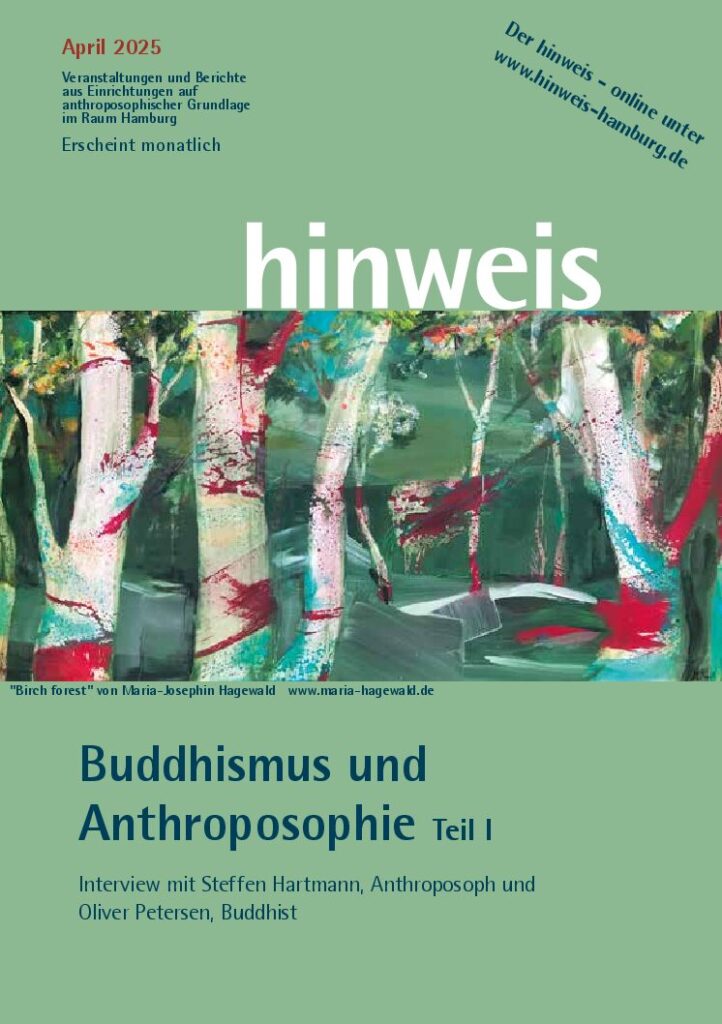Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
Initiativ werden, gründen und entwickeln I und II
Dr. Jan Uhlmann: Kleiner Fahrplan für Pioniere und Menschen, die ihre Einrichtung voranbringen wollen
Artikel von Dr. Jan Uhlmann

Wer hat nicht schon davon geträumt, sich allein oder mit anderen gemeinsam selbständig zu machen, eine Einrichtung, ein Unternehmen oder ein Institut ganz nach den eigenen Vorstellungen zu gründen? Manchen gelingt es, andere scheitern, die Dritten fangen erst gar nicht an. Warum sind manche Bemühungen von Erfolg gekrönt? Warum verschwinden Gründungsimpulse wieder ganz von der Bildfläche? Entscheidend sind nicht nur Idee und Tatkraft der Gründer sondern auch die Art und Weise, wie sich der Impuls in die Welt einlebt, die Resonanz, das Mittun der anderen: Mitstreiter, Kunden, Nutzer.
Dr. Jan Uhlmann studierte Wirtschaftswissenschaften in Hamburg und München. Er ist als Unternehmensberater bundesweit überwiegend für Unternehmen der Wohnungswirtschaft tätig. Darüber hinaus berät und begleitet er die Entwicklung kleinerer, auch selbst verwalteter Organisationen und Einrichtungen, führt Seminare zu menschenkundlichen Themen durch und arbeitet im Vorstand des Bau-Vereins Hamburger Anthroposophen e.V. und der MIKA Rothfos Stiftung mit. Er lebt in Hamburg, ist verheiratet und hat drei Kinder.
Jeder Gründungsimpuls hat eine ganz individuelle Signatur. Aber für die Entwicklung, die er im Erfolgsfall nimmt, lässt sich ein Grundmuster von 7 Phasen ausmachen. Jede erfordert bestimmte Kräfte und Qualitäten und ist weder austauschbar noch kann sie übersprungen werden. Gelingt es, sie zur rechten Zeit auszubilden, geht es weiter voran. Gelingt es nicht, sind Schwierigkeiten vorprogrammiert.
Diese 7 Schritte, die im Grundsatz für alle sozialen Initiativen, z.B. auch für die Gründung eines kleinen Arbeitskreises gelten, folgen einem geistigen Entwicklungsgesetz, einem Urbild von Entwicklung, das Rudolf Steiner u.a. in seiner Geheimwissenschaft beschrieben hat. Jede der Phasen, die wegen ihrer charakteristischen Prägung mit einem „Planeten“-Namen bezeichnet wird, steht für Basisqualitäten, die sich im weiteren Verlauf metamorphosieren und immer weiter durch Neues ergänzt werden.
Ob ein Mensch, eine Gruppe eine tragfähige Gründungs-Intuition hat, ob die Kraft da sein wird, den Gründungsweg zu gehen, lässt sich nicht vorhersagen. Aber wenn sich Menschen auf den Entwicklungsweg machen, ist die Beachtung dieser Wegmarken sehr hilfreich, und kann vor Um- und Irrwegen bewahren.
Am Anfang Unruhe und Begegnungen
Viele Gründerpersönlichkeiten berichten, dass sie sich am Anfang in einer Art kreativem Unruhezustand befanden. Man ist unzufrieden mit der persönlichen Situation, der bisherigen beruflichen Tätigkeit. Man erwägt dies und das, hat Ideen, verwirft sie wieder, kann sich zunächst noch nicht zu konkreten Schritten entschließen. Ganz wichtig sind in dieser Phase Begegnungen, Gespräche mit anderen, Fragen.
Die Grundqualität, auf die es am Beginn ankommt, lässt sich mit dem Begriff Wärme (Saturn-Qualität) charakterisieren. Sie wandelt sich später zu Motivation und Begeisterung, und sollte im weiteren Prozess nicht verloren gehen.
Die zündende Idee
Irgendwann ist sie nach längerer oder kürzerer Inkubationszeit da: die zündende Idee. Sie kann als blitzartiger Einschlag erlebt werden, sie kann sich aber auch allmählich aus einem Wust vielfältiger Erwägungen herausschälen. Ob sie erfolgreich sein wird, wissen wir noch nicht, aber sie zentriert von nun an alle Kräfte, ob bei einem Einzelnen oder bei einer Gruppe, und richtet sie auf das gemeinsame Ziel aus.
In nicht wenigen, zunächst durchaus erfolgreichen Einrichtungen geht dieser klare Fokus im Laufe der weiteren Entwicklung wieder verloren. Aus Licht (Sonnen-Qualität) wird wieder Halbdunkel. Man beginnt, gegeneinander zu arbeiten oder auch nur einfach abzuwarten. In diesem Fall kann eine richtig verstandene Leitbildarbeit – nicht nur im Kreis der Führenden sondern auf breiter Basis angelegt – helfen, die Orientierung zu erneuern, sie gegebenenfalls auch neu auszurichten.
Unterstützung sichern, Voraussetzungen schaffen
Jetzt kann die eigentliche Vorbereitungsarbeit beginnen: Was wird benötigt, was werden die Lebensgrundlagen des neuen Impulses sein (Monden-Qualität): Pläne, Marktstudien, Beschaffung von Eigenkapital, Zusage von Finanzierungsmitteln durch Dritte, engagierte und qualifizierte Mitstreiter, ein geeignetes Grundstück für ein Bauvorhaben, die geeignete Rechtsform, Genehmigungen etc. Die Idee ist etwas Geistiges. Zu ihrer Verwirklichung benötigt sie irdische Ressourcen. Je besser es gelingt, die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, umso größer ist die Chance auf Erfolg.
Gleichwohl gibt es auch Situationen, die die Initiatoren zu raschem Handeln zwingen. Bei so einer „Sturzgeburt“ ist die Gründung häufig von Anfang an in einen harten Existenzkampf verwickelt: Immer ist das Geld knapp. Ungeklärte innere und äußere Formfragen führen zu endlosen, Kräfte zehrenden Diskussionen. Immer wieder stellt sich die Frage, ob es Sinn hat, weiter zu machen. Auch in der späteren Entwicklung darf das Gleichgewicht zwischen Idee und Ressourcen nie aus den Augen verloren werden.
Der Pionier tritt in die Welt
Jetzt kann gegründet werden. Der Impuls tritt für alle sichtbar in die Welt. Überleben und sich weiter entwickeln wird er durch proaktives unternehmerisches Handeln, Risikobereitschaft und die flexible Bündelung aller Kräfte (Mars-Qualität). Herz des Ganzen ist der Pionier oder die Pioniergruppe. Alles ist auf dieses Handlungszentrum ausgerichtet. So kann höchst flexibel reagiert werden. Das ist gerade in der frühen Pionierzeit überlebensnotwendig. Alles dreht sich um das Tagesgeschäft. Pläne werden rasch über den Haufen geworfen, wenn sie nicht den kurzfristigen Erfolg versprechen. Das erfordert Hingabe an die gemeinsame Mission und Begeisterung – der Pionier immer an der Spitze. Wenn das Tu-was-Prinzip, die Führung durch einen begeisterten Pionier im Laufe der weiteren Entwicklung verloren gehen, ist Arbeit an Führungsqualität und proaktivem Handeln angesagt.
In der fortgeschrittenen Pionierphase machen sich häufig hinderliche Nebenwirkungen bemerkbar: Der Pionier wird nicht mehr als zentrale Autorität sondern eher als Autokrat erlebt. Die Mitstreiter werden es leid, an seinem sichtbaren oder unsichtbaren Zügel gegängelt zu werden. Sie wünschen sich eigene Gestaltungsräume, um voranzukommen. Wenn der Impuls sich weiterentwickeln soll, muss eine Metamorphose stattfinden: Der Pionier muss die Mitte freigeben, und kann sich in einer neuen Rolle – als Leader – z.B. verstärkt um die Außenbeziehungen kümmern. Dieser Schritt fällt vielen Pionieren sehr schwer, und muss dann bisweilen als konfliktbeladener Kraftakt vollzogen werden.
Loslassen und differenzieren
In der neuen Entwicklungsphase geht es jetzt nicht mehr darum, dass alle im Prinzip alles machen, sondern dass eindeutige Verantwortlichkeiten abgegrenzt und untereinander gegliedert werden. Differenzierung ist angesagt (Merkur-Qualität). Innerhalb der einzelnen Verantwortungsbereiche – in selbst verwalteten Einrichtungen häufig Delegationen – können jetzt viel stärker als vorher fachliche Kompetenz, Erfahrungswissen und Professionalität ausgebildet werden. Qualität wird auf eine neue Stufe gehoben.
Einer Einrichtung im fortgeschrittenen Differenzierungsstadium drohen Gefahren von zwei Seiten: Das möglicherweise feingliedrig ausdifferenzierte System kann sich verhärten. Es bilden sich kleine Fürstentümer, die mehr gegeneinander als miteinander arbeiten – der Kunde gerät aus dem Blickfeld. Oder es stellen sich Auflösungserscheinungen ein nach dem Motto „Alles ist geregelt aber keiner hält sich dran“. Beide Phänomene sind ein deutliches Indiz dafür, dass ein weiterer Entwicklungsschritt notwendig wird.
Integration durch Teams und Prozesse
Um die vielfältigen Egoismen zu überwinden, die sich in der fortgeschrittenen Differenzierungsphase herausgebildet haben, ist jetzt Integration angesagt (Jupiter-Qualität): Aus Einzelkämpfern müssen echte Teams werden. Statt auf die Bewahrung und Verteidigung interner Strukturen muss der Blick jetzt konsequent auf Geschäftsprozesse gehen, die den Kundennutzen zum Ziel haben. Dabei darf die erworbene Professionalität im eigenen Aufgabenbereich nicht etwa dadurch verloren gehen, dass sich jetzt wieder jeder um alles kümmert und nichts richtig gemacht wird. Ein Gesamtbewusstsein, das es in der Pionierphase dem Gründer ermöglichte, den Impuls am Leben zu erhalten, wird jetzt in neuer Form von allen, zuvorderst von den Führungskräften gefordert – in selbst verwalteten Einrichtungen dem inneren Kreis der Verantwortungsträger.
Eine Einrichtung, die den Schritt in die Integrationsphase geschafft hat, ist in aller Regel hoch leistungsfähig. Vor diesem Hintergrund droht eine neue Gefahr: Möglicherweise stellt sich jetzt eine gewisse Arroganz ein, die die Organisation aus ihren tragenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebenszusammenhängen herauszulösen droht. Der Marktzusammenhang wird dann zunehmend durch Machtausübung oder Manipulation gegenüber Kunden, Lieferanten und der Öffentlichkeit gesichert.
Teil eines größeren Ganzen
Wir ahnen, dass mit der Integrationsphase noch kein Schlusspunkt gesetzt sein kann. Als Vision taucht ein Bild auf, in dem das abgegrenzte, bei aller Beteuerung von Kundenorientiertheit letztlich doch egoistische, mit anderen in Konkurrenz stehende Eigenwesen von Unternehmen und Einrichtungen in einem großen assoziativen Netz aufgeht (Venus-Qualität). Nicht der alles beherrschende, monopolistische Weltkonzern ist gemeint sondern stabile und lebendige Bewusstseins-, Vertrauens- und Vereinbarungsketten zwischen allen Akteuren. Das einzelne Unternehmen stellt sich selbstlos in den Dienst eines größeren Aufgabenzusammenhangs. Anschauungsbeispiele gibt es in weltweiten Netzwerken wie dem Online-Lexikon Wikipedia oder der Software Linux, an denen bei völliger Öffnung die unterschiedlichsten Fachleute zusammenarbeiten, und ihr Produkt den Interessenten auf Spendenbasis oder sogar kostenfrei zur Verfügung stellen.
Theorie und Praxis
Für den Weg vom Ursprungsimpuls einer Gründung bis zur Assoziationsphase gibt es keinen Automatismus. Wir sind jederzeit frei, zu wählen. Aber wenn die geschilderten Wegmarken bewusst angesteuert werden, wird vieles leichter. Wenn man sie missachtet, z.B. versucht zu springen oder an einer Stelle einfach stehen zu bleiben, sind ggf. schmerzliche Konsequenzen bis hin zur Auflösung die Folge.
Innerhalb größerer Organisationen können unterschiedliche Phasen parallel auftreten. Zum Beispiel wird ein neuer Geschäftszweig aufgebaut. Dort sollte Pioniergeist herrschen. Typischerweise würden sich die Menschen, die hier tätig sind, vom übrigen Apparat, der die Differenzierungsphase durchlebt, eher behindert und eingeschränkt fühlen. Umgekehrt schaut der Rest des Unternehmens mit Misstrauen auf das Ungeregelte, das Chaotische des neuen Bereichs.
Erfahrene Unternehmenspraktiker berichten, dass sie die Entwicklungsphasen bei sich nicht eindeutig unterscheiden können, da alles gleichzeitig wirkt. Da ist es hilfreich zu unterscheiden zwischen den Grunderfordernissen der gegenwärtigen Phase, den Früchten aus der Vergangenheit und Zukünftigem, das bereits jetzt hereinleuchtet.
Bei allem gilt es die Mitte zu halten zwischen Erstarrung und Auflösung. Ein diktatorisch und willkürlich handelnder Pionier ist im Zweifelsfall eine genauso große Existenzgefährdung wie sein unerwarteter, alle Beteiligten völlig überfordernder Rückzug.
Helfer und Hindernisse aus der geistigen Welt
Die 7 Schritte sind ein Fahrplan ohne Zeitangaben. Viele weitere Faktoren wirken mit. Drei davon, die in der Regel nicht genügend Beachtung finden, seien hier kurz angesprochen:
Nicht von ungefähr spricht man davon, dass in einer Einrichtung ein bestimmter Geist herrscht – z.B. ein Geist des Aufbruchs, des organischen Voranschreitens oder auch des Kleinkarierten. Hier manifestiert sich etwas Überpersönliches, das im Guten wie im Schlechten eine enorme beharrende bzw. verstärkende Kraft entfalten kann. Dieser Geist wird u.a. erkennbar an den „geheimen Spielregeln“. Das sind interne, niemals vereinbarte Regeln, nach denen man miteinander umgeht, und die häufig in krassem Gegensatz zu offiziellen Leitbildern und Verhaltensgrundsätzen stehen. Wer diesen Geist oder Ungeist nicht beachtet, wird sich schwer tun, der weiteren Entwicklung die richtigen Impulse zu geben.
Rudolf Steiner hat den Hinweis gegeben, dass Menschen, die im Leben stark gewollt haben (Willensstau), die Möglichkeit haben, aus dem Nachtodlichen ins Soziale hinein zu wirken. Menschen mit Offenheit gegenüber der geistigen Welt können spüren, wie stark manche Gründer auch noch nach ihrem Tod mit ihrem Werk verbunden sind. Es können auch geistige „Paten“ wirksam werden, denen sich eine Einrichtung z.B. schon in ihrer Namensgebung verpflichtet. Wenn es gelingt, sich bewusst in eine Beziehung zu Verstorbenen zu setzen, kann damit für die Einrichtung ein nicht zu unterschätzender realer Kraftquell für die weitere Entwicklung erschlossen werden.
Schließlich kann man bei vielen Einrichtungen den Eindruck gewinnen, dass nicht der reine Zufall bestimmte Menschen hier zusammen geführt hat. Im Gegenteil: Sie scheinen bisweilen im Guten wie im Schlechten für einander bestimmt zu sein. Besonders deutlich wird dies bei gravierenden, lang anhaltenden Konfliktsituationen, die die Beteiligten geradezu aneinander fesseln. Hier kann es im Interesse nicht nur der unmittelbar Beteiligten sondern der Weiterentwicklung der gesamten Einrichtung hilfreich sein, den Blick auf mögliche Schicksalsaufgaben und Schicksalsknoten zu lenken, die bewältigt bzw. gelöst werden wollen.
Christine Pflug: Die Abfolge dieser Phasen hört sich sinnvoll an, sie ist auch geistig begründet, aber kann die Gründung einer Initiative in der Realität nicht auch ganz anders ablaufen, z. B. dass Phasen ausgelassen werden?
Dr. Jan Uhlmann: Wer eine Phase auslässt, bekommt mit Sicherheit ein Problem, u. U. sogar ein massives. In anthroposophischen Einrichtungen ist nach meiner Wahrnehmung die Differenzierungsphase wenig beliebt; in der Pionierphase sind alle begeistert dabei, aus der Zukunft leuchtet die Integrationsphase mit Teamarbeit auf. Die Differenzierungsphase dazwischen erscheint dann sperrig: sortierte Verantwortungsbereiche, in denen der Einzelne eine eigene Aufgabe zu verantworten hat und sich am Ergebnis auch messen lassen muss. Das wird als beschwerlich erlebt, und deshalb streben manche gleich in die Integrationsphase. In der Differenzierungsphase muss aber gelernt werden, auf sich alleine gestellt voll verantwortlich zu sein und in diesem eigenen Bereich gute Qualität zu bringen. Wenn das nicht gelernt wird, gibt es in der Integrationsphase einfach Murks durch mangelnde Professionalität.
In anderen Einrichtungen wird die Differenzierungsphase dagegen als Befreiung erlebt: Die Pionierphase ist stark durch den Pionier oder die Pioniergruppe geprägt, was im ungünstigen Fall bis ins Diktatorische gehen kann. Die Differenzierungsphase mit ihren abgegrenzten Einzelbereichen bietet dem Einzelnen einen Schutz: „Hier bin ich tätig, da redet mir keiner rein und ich kann mich entfalten.“
C. P.: Pionierphase heißt auch, dass alle alles machen. Oder ist der Pionier derjenige, der das Ganze vorantreibt?
Dr. J. Uhlmann: Ohne Pionier oder Pioniergruppe kommt nichts zustande. Man kann ein neues Unternehmen nicht bürokratisch aufbauen, sondern es müssen Menschen da sein mit Begeisterung und der Fähigkeit, andere Menschen anzuziehen.
C. P.: Was zeichnet einen guten Pionier, bzw. Unternehmer aus?
Es ist eine Tragik, dass Unternehmer-Sein heute pauschal in Verruf gekommen ist
Dr. Jan Uhlmann: … dass er etwas unternimmt. Es ist im Grunde eine Tragik, dass Unternehmer-Sein heute pauschal in Verruf gekommen ist. Dabei brauchen wir viel mehr Unternehmer, sowohl im Wirtschafts- als auch im Geistesleben. Das sind Menschen, die die Intuitionsfähigkeit haben, Neues aufzunehmen. Andererseits haben sie auch die Kraft, etwas durchzutragen. Ein guter Unternehmer muss genau diese Qualitäten haben. Später muss er auch genügend flexibel sein, zum passenden Zeitpunkt seine eigene Rolle zu überdenken. Wenn er das nicht richtig erkennt, kommt die ganze Einrichtung in große Schwierigkeiten.
gute Mitarbeiter kann man auf Dauer nicht in einer Pioniersituation halten
C. P.: An welchen Signalen kann der Pionier erkennen, dass er sich zurückziehen muss?
Dr. J. Uhlmann: In einer frühen Phase der Gründung ist es für die Einrichtung lebensbedrohlich, wenn der Pionier plötzlich ausfällt. Wenn eine Einrichtung aber die ersten sieben Jahre überstanden hat, so sagt man, dann geht es auch in der Zukunft weiter, und dann sind auch schon viele andere Mitarbeiter dabei. Der Pionier muss dann lernen, in die anderen Vertrauen zu haben und nicht nur alles über sich selbst laufen zu lassen, „weil man es selbst am besten weiß und kann“. Gute Mitarbeiter kann man auf Dauer nicht in einer Pioniersituation halten, weil die sich selbst weiterentwickeln wollen. Schließlich muss der Pionier auch eine Vision für seine neue Rolle entwickeln, z.B. mehr in den Umkreis der Einrichtung gehen, einen Beirat bilden, herumreisen und Vorträge halten.
C. P.: Das fällt solchen Menschen aber recht schwer, weil Ihre ganze Identität mit der Einrichtung verbunden ist …
Dr. J. Uhlmann: Das können sie dann bisweilen gar nicht mehr unterscheiden. In manchen Einrichtungen werden dann diese alt gewordenen Pioniere „mit dem Schneidbrenner losgelöst“; das geht bis zu Hausverbot, Türschlösser auswechseln usw.
C. P.: Gibt es Einrichtungen im Geistes- und Wirtschaftsleben, die in der Integrationsphase und Assoziationsphase angekommen sind? Wie sieht das beispielsweise aus?
Dr. J. Uhlmann: In der Differenzierungsphase sind es die einzelnen „Kästchen“, d. h. Gruppen, die gleichartige Arbeit unter einem Vorgesetzten machen, z. B. Rechnungswesen, Marketing etc. Sie stehen zu anderen Gruppen, d. h. Arbeitsbereichen, in Beziehung, aber vor allem hat die Einzelverantwortlichkeit Vorrang. Durch diese Aufgliederung geht das Bewusstsein für das Ganze ein Stück weit verloren – „Wofür sind wir eigentlich da?“
„Ihr macht das Ganze jetzt gemeinsam“
Um ein Beispiel zu nennen: In der Wohnungswirtschaft hat man üblicherweise eine Vermietungsabteilung, eine für Betriebskostenabrechnung, eine für Forderungsmanagement, es gibt eine Hausmeisterorganisation etc. In der klassischen Differenzierungsphase arbeiten diese Abteilungen für sich, mit ihrem jeweiligen Vorgesetzen. Irgendwann erkennt man zwangsläufig, dass sie ja alle für die gleichen Objekte, die gleichen Kunden arbeiten, und nun bringt man alle, den Zuständigen für Betriebskosten, für Verwaltung, für Vermietung, zusammen: „Ihr macht das Ganze jetzt gemeinsam“. Das setzt voraus, dass jeder sein Fach beherrscht.
am Leitbild arbeiten
C. P.: Wenn man in einem solchen Betrieb mit vielen Mitarbeitern in ausdifferenzierten Bereichen wieder ein Leitbild erstellen muss – wie macht man es, dass alle motiviert sind und sich mit dem Ziel identifizieren können?
Dr. J. Uhlmann: Zum Teil dient die Leitbildarbeit genau diesem Zweck. Das Unternehmen ist jetzt vielleicht 20 oder 30 Jahre alt. Früher kannten alle das gemeinsame Ziel, im Laufe der Zeit wurde es unscharf, ging verloren. Da kann es schon richtig sein, eine Leitbildarbeit anzulegen, aber nicht so, dass der oberste Führungskreis sich etwas Gutes und Richtiges ausdenkt, aber alle anderen nicht an dem Prozess beteiligt. Der Prozess ist das Wesentliche, und der kann ruhig ein Jahr dauern. Vielleicht stehen nachher ganz schlichte Sätze da, aber es waren alle daran beteiligt und sie sind motiviert.
In größeren Unternehmen können beispielsweise Vertreter einzelner Gruppen beteiligt werden, und sie informieren ihrerseits dann wieder die Gruppe. Heutzutage hat fast jeder einen Bildschirm an seinem Arbeitsplatz und über Intranet kann jeder sich einbringen. Gut ist eine sinnige Gesamtdramaturgie, beispielsweise mit einem schönen Fest als Höhepunkt, wo die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen eingebracht und gewürdigt werden.
„heimliche Regeln“
C. P.: Manche Betriebe oder Einrichtungen haben „heimliche Regeln“. Welche können das beispielsweise sein?
Dr. J. Uhlmann: Jedes Unternehmen hat offizielle Spielregeln. Das sind Anweisungen und Stellenbeschreibungen, möglicherweise sind auch Verhaltensgrundsätze vereinbart worden. Wenn man genau hinschaut, stellt man fest, dass die Menschen aber in Teilen etwas ganz anderes machen, und zwar alle in gleicher Weise. Zum Beispiel kann die offizielle Spielregel heißen: wir sind kreativ und innovativ. Und die heimliche Spielregel heißt: ich darf mich nicht bei Fehlern erwischen lassen. Das führt beispielsweise dazu, dass ständig Aktenvermerke geschrieben werden um sich abzusichern: man hat vor einem bestimmten Schritt gewarnt, man ist nicht dafür verantwortlich etc. Es ist enorm viel tote Zeit, die darauf verwendet wird.
Es gibt auch eine andere Variante: Wenn ein neues Projekt losgeht, wollen alle dabei sein, am Erfolg beteiligt sein. Wenn dieses Projekt dann in eine kritische Phase gerät, sind eine ganze Reihe von Leuten auf einmal gar nicht mehr da. „Es könnte ja sein, dass das ein Fehlschlag wird, und wenn ich dann dabei gewesen bin, kann man mir das nachher anlasten.“
Das sind Mechanismen, die völlig im Gegensatz zu den offiziellen Spielregeln stehen – ein Ungeist ist da eingezogen. Wenn man die Mitarbeiter danach fragt, werden sie das auch bestätigen, trotzdem ändert das aber nichts daran.
C. P.: Wie und warum schleicht sich so etwas ein?
Dr. J. Uhlmann: Letztlich geht das von der Führungsmannschaft oder den Vorgesetzten aus. Wenn Chefs da sind, die ihre Mitarbeiter deutlich spüren lassen, dass sie Fehler nicht dulden, nützt es nichts, wenn im Leitbild von Kreativität und Innovation die Rede ist. Niemand wird sich auf ein Wagnis einlassen.
C. P.: Wie ist das, wenn auch offiziell gar keine Regeln da sind? Das ist ja in selbst verwalteten, non-Profit Betrieben manchmal der Fall … Keiner will sich zum Chef aufspielen, die Gruppe ist aber auch nicht genügend geschult, um Richtlinien und Strukturen festzulegen.
„heimlichen Chefs“, denen niemand eine Befugnis erteilt hat, die aber vieles bestimmen
Dr. J. Uhlmann: Es braucht die Differenzierungsphase mit der entsprechenden Professionalisierung. In selbst verwalteten Betrieben sind zwar auf der Rechtsebene alle gleich, aber was Professionalität und Können anbelangt muss man doch bestimmte Bereiche an Einzelne delegieren. Es hilft nicht weiter, wenn die Mitarbeiter den Anspruch haben: „Wir sind alle ein Team und machen alles gemeinsam und wollen keinen Chef.“ Regelmäßig gibt es dann die „heimlichen Chefs“, denen niemand eine Befugnis erteilt hat, die aber vieles bestimmen.
Menschen, die mit Personalfragen betreut sind
C. P.: Schwierig wird es in solchen Situationen, wenn bestimmten Mitarbeitern Anweisungen und Rückmeldungen gegeben werden müssen …
Dr. J. Uhlmann: Es muss auf irgendeine Weise ein Personalorgan geben, in dem gestandene, erfahrene, sozial kompetente Menschen sind – das kann u. U. auch nur ein Mensch sein. Beispielsweise gibt es ja das äußerst heikle Thema der Gehaltsfindung; es ist total unangemessen, in einem großen Kollegium die Notlage eines einzelnen Kollegen zu besprechen; oder auch, wenn es um Entlassungen geht. Kein normaler Wirtschaftsbetrieb würde das in einem großen Kreis besprechen, man kann bei solch persönlichen Fragen zu viel zerstören und verletzen.
Menschen, die mit solchen Personalfragen betreut sind, haben natürlich eine Machtposition, und deshalb müssen sie diese Aufgabe mit einem Stück Selbstlosigkeit wahrnehmen.
C. P.: Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite müssen sie es wagen, sich unbeliebt zu machen und unangenehme Dinge mitzuteilen.
dann fängt das Mobbing an
Dr. J. Uhlmann: Aber wenn jedermann weiß, dass es diese Aufgabe einfach gibt und dass ein Bestimmter dieses macht, dann ist das viel besser, als wenn es nicht aufgegriffen wird. Denn dann fängt das Mobbing an: Kollegen sind ihrer Aufgabe vielleicht nicht gewachsen, sind sich darüber aber nicht so richtig im Klaren, es wird ihnen auch nicht gesagt und dann werden sie gemobbt.
C. P.: Wer ernennt in einem selbst verwalteten Betrieb diesen Personalverantwortlichen?
Dr. J. Uhlmann: Es muss irgendwann eine Delegation geben: man verständigt sich darüber, dass man so etwas braucht; es gibt zu viele Scherben, wenn man gar nichts macht. Und dann wählt man jemanden im Konsens, der das übernehmen würde.
karmische Beziehungen im Arbeitsleben
C. P.: Man spricht in anthroposophischen Kreisen immer gerne von Karma. Kann man, nach Deiner Erfahrung, das so benennen oder sind es die üblichen Verstrickungen im Arbeitsleben, die es überall gibt?
Dr. J. Uhlmann: Was ist „üblich“ … Bernard Lievegoed hat einmal gesagt, dass in jeder Gruppe, die etwas länger zusammen ist, Karma waltet. Das würde ich so absolut nicht sagen. Für mich zeigen sich karmische Verbindungen aber dann, wenn Menschen konsequent gegeneinander arbeiten und es Konflikte und Streitereien gibt, und was dann gerade nicht dazu führt, dass – was nahe liegend wäre – einer geht. Nein – sie bleiben wie aneinander gefesselt, was den Streit enorm steigert und „Blut fließen lässt“. Sie kommen einfach nicht auseinander. Karma gibt es auch im Positiven, nur hat man da als Berater weniger Einblick. Ich habe in diesen schwierigen Situationen den Betreffenden meine Vermutung einfach mal gesagt. Das Ergebnis war in der Regel, dass man mir zustimmte, es sich aber nichts änderte. Menschen können es heute noch nicht wirklich tief in sich reingehen lassen: „Könnte das wirklich mein Karma sein? Was heißt das denn, dass wir etwas miteinander auszumachen haben, was aus unserer jetzigen Zusammenarbeit alleine gar nicht zu erklären ist? Wo ist da für mich ein Entwicklungsschritt möglich?“ Das passiert ganz selten. Als Berater kann man froh sein, wenn es gelingt, die Betreffenden halbwegs verträglich auseinander zu bringen.
C. P.: Wenn einer bereit wäre, die Konflikte als Teil seines Karmas anzunehmen: Was könnte der denn machen?
Dr. J. Uhlmann: Wenn, im besten Fall, beide Parteien das wirklich so annehmen würden, und zwar nicht nur im Kopf, wäre das Problem schon weitgehend geklärt. Aber dass man es schafft, auch nur ein vages Bild davon zu gewinnen, „wir beide haben irgendeinen Schicksalsbezug miteinander, den wir lösen sollten, um frei zu werden“ – das fällt uns heute noch schwer. Es wäre dann eine Haltung: da ist keine Störung, sondern eine Aufgabe. Ich glaube, dass das ausstrahlen würde, ohne dass man dann viel darüber reden müsste.
Unterstützung aus der Welt der Verstorbenen
C. P.: Du hast in Deinem Artikel geschrieben, dass Einrichtungen Unterstützung erhalten können aus der Welt der Verstorbenen. Wie kann sich das ganz praktisch auswirken?
Dr. J. Uhlmann: Ich hatte schon vor vielen Jahren bei Rudolf Steiner gelesen, dass Menschen, die im Leben mehr gewollt haben, als sie realisieren konnten, nach dem Tod aus der geistigen Welt ins Soziale hinein wirken können. Das war für mich zunächst reine Theorie. Später habe ich die Heileurythmieausbildung Hamburg mitbegründen dürfen, und habe das Ganze von der finanziellen, wirtschaftlichen und organisatorischen Seite her angesehen und begleitet. Ich hatte mich damals immer gewundert, warum alles so gut läuft – was normalerweise eigentlich gar nicht zu verstehen war: Wir hatten auch ohne Werbung immer genügend geeignete Studenten, die richtigen Dozenten, einen großzügig zur Verfügung gestellten Raum, genügend Finanzmittel …
Später ist mir dann ein Zusammenhang mit Rudolf Steiners Aussage aufgefallen: Wir hatten schon bei der Gründung Paten aus der geistigen Welt „gebeten“, zwei verstorbene Heileurythmistinnen, später noch ein Arzt, der während der Ausbildung gestorben ist. Es ist in mir das Bild gewachsen, dass da ein Zusammenhang besteht.
Natürlich greifen Verstorbene nicht von sich aus ein und machen etwas, sondern man muss die Beziehung zu ihnen pflegen.
Mir ist danach klar geworden, dass es sicherlich viele Beispiele dafür gibt in mittelständischen Unternehmen. Der Gründer ist gestorben, es ist aber noch der Geist des Gründers da, seine Werte sind noch lebendig, die Mitarbeiter sagen: „Der Alte hätte das so und so gemacht“. Das kann man rein psychologisch sehen, aber unter spiritualistischen Gesichtspunkten kann man das als eine reale Wirksamkeit aus der geistigen Welt betrachten, dass der Gründer aus dem Nachtodlichen noch den Zusammenhang hält und das Ganze fördert.
C. P.: Du hast geschrieben, der Anfang einer Initiativgründung sei eine innere Unruhe und Unzufriedenheit mit dem Bestehenden. Wenn man sich heute das Arbeitsleben anschaut, gäbe es genug Anlässe, etwas Neues zu beginnen. Aber was braucht es noch, damit eine Initiative entsteht?
Dr. J. Uhlmann: Wir bräuchten jede Menge neuer Initiativen auf allen Gebieten. Es ist nicht notwendig, dass einer „die“ großartige Idee haben muss, sondern es kann vieles erst auch mal im Stillen wachsen und gedeihen. Ich bin mir sicher, dass an Intuitionen, die dafür die Voraussetzung sind, dass jemand initiativ wird, gar kein Mangel ist. Woran es mangelt ist, dass Geistesblitze wirklich angenommen und dann auch durchgetragen werden. In der geistigen Welt ist alles vorhanden, was wir heute brauchen.