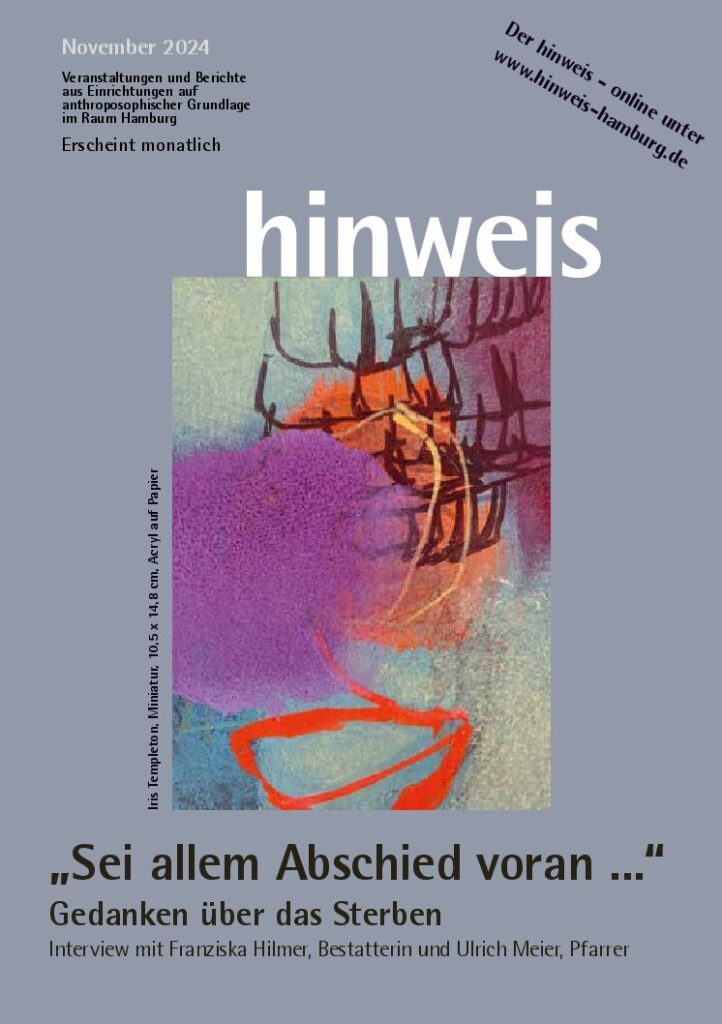Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
Tod und Leben
Interview mit Tom Tritschel, Pfarrer, Künstler, Dozent für Sozialgestaltung

Tod und Leben gehören unabdingbar zusammen. Es gibt keinen Schöpfungsprozess, welcher Art auch immer, der ohne Todespunkte funktioniert. Das Bewegungselement, das wir Leben nennen und was Wachstum und Fortpflanzung enthält, braucht selbst die Todeselemente, um überhaupt in Gang zu bleiben. Sie führen zu einem „Aufhören“ und ermöglichen damit Neues.
Die Kunst ist der Weg, in dem man die Aufmerksamkeit schult, diese Todespunkte wahrzunehmen, um sie dann schöpferisch wirksam machen zu können.
Tom Tritschel hielt im Hamburger Priesterseminar Anfang November 2012 ein Seminar, das für externe Zuhörer zugelassen war.
Interviewpartner: Tom Tritschel, geb. 1958 in Weimar; Sportschule Eisschnelllauf, Abitur, Schriftsetzer, Gartenarbeiter, Fensterputzer, Punk-Band, Studium Malerei und Grafik bei Horst-Peter Meyer in Weimar, FIU, Demokratie-Initiative 89/90, Neues Forum, Studium am Priesterseminar der Christengemeinschaft in Leipzig und Stuttgart, Arbeit mit mehrfachschwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen, Priesterweihe 1993, Pfarrer in der Christengemeinschaft in Bochum, Dozent für Sozialgestaltung am Priesterseminar der Christengemeinschaft in Hamburg; verheiratet, fünf Kinder, fünf Enkelkinder.
Christine Pflug: Was ist Tod?
Tom Tritschel: Das, was jeder zunächst unter Tod versteht, ist der eigene physische Tod am Ende des Lebens. Zuverlässige Aussagen darüber zu machen fällt schwer, weil man, trotz aller Nahtodforschungen, nichts darüber weiß. Und selbst diese bewegen sich nur in einer Art Näherung auf diesen Punkt zu – tatsächlich haben wir ihn ja noch nicht überschritten. Wir vermengen mit dem Tod meist die Prozesse, die dahin führen, und die würde ich eher als Sterben beschreiben, aber nicht diesen konkreten Moment – bei dem sich die Frage stellt, ob er überhaupt eine Zeitdimension hat.
C. P.: Könnte man also sagen: Sterben ist ein Weg und Tod ein Punkt?
T. Tritschel: Ja! Und das ist keineswegs nur eine Figur, die sich nur auf den Tod am Ende eines Lebens bezieht, sondern jede Entwicklung enthält dieses Zusammenspiel von Prozessualem und Punktuellem. Es entwickelt sich etwas eine Zeitlang, und dann gibt es immer in irgendeiner Weise einen Punkt, an dem etwas umschlägt, d. h. eine Art Sprung macht, mitunter mit einer gewissen Unberechenbarkeit behaftet. Manchmal knallt es dann – etwas ist zu Ende, es geht so nicht weiter.
C. P.: Sie haben auf dem Seminar gesagt, dass der Tod kommen kann entweder durch Verhärtung oder durch Auflösung. Wie kann man das bei dem, was Sie gerade beschrieben haben, beobachten?
T. Tritschel: Wir hatten eben den Moment des Todespunktes im Blick. Dieser Todespunkt steht dem Prozessualen gegenüber, d. h. etwas, das sich weiterbewegt. Gewöhnlich setzt man Tod in eine Polarität zum Leben, sieht es als das genaue Gegenteil an, also Abwesenheit von Entwicklung, Schluss mit Bewegung.
Aber dieses Bewegungselement, das wir vielleicht Leben nennen und was Wachstum und Fortpflanzung enthält, braucht selbst diese Todeselemente, um überhaupt in Gang zu bleiben. In diesem Prozess sind das wiederum polare Todesprozesse, die zu einem solchen „Aufhören“ führen und damit auch Neues ermöglichen. Da gibt es diese Punkte, wo es Spitze auf Knopf geht, und es schlägt in eine neue Qualität um; wie bei einer Pflanze, bei der aus grün dann rot wird: Es gibt einen Stau, dann stülpt es sich um, und es ist etwas gänzlich anderes da, z. B. eine Blüte. Es geht durch einen Nullpunkt durch.
allmähliche Auflösungserscheinungen
Es gibt aber auch die allmählichen Auflösungserscheinungen, die ebenfalls zu einem Aufhören führen. Beispielsweise fallen Blätter einfach ab und verwesen, das passiert nicht plötzlich, sondern braucht eine ganze Zeitlang. Es fängt in jeder Art von Leben schon sehr früh an, dass es Abbauprozesse gibt, Sterbeprozesse, die eine etwas andere Gebärde haben. Sie haben eine Auflösungsgebärde und irgendwann ist diese Sache nicht mehr brauchbar, zerfällt in Bestandteile oder löst sich gänzlich auf. Auch dabei gibt es einen Augenblick, wo man sagen kann: Jetzt ist es nicht mehr da. Bis zu einem bestimmten Moment hängt der Apfel noch am Baum, und irgendwann fällt er einfach ab. Und später ist er dann endgültig verwest und nicht mehr da.
Es ist eine andere Gebärde, wenn etwas so stirbt, dass es nach und nach entschwindet, sich verflüchtigt, verdampft. Im Physischen und auch im Seelischen oder Geistigen gibt es Dinge, die sich verflüchtigen und dann gestorben und tot sind. Im anderen Fall ist es so, dass sich etwas so lange verdichtet, bis das Leben „rausgequetscht“ ist. Es ist so verhärtet, dass es nicht mehr lebensfähig ist.
C. P.: Da kommt man auf eine interessante Polarität: Sie sagen, das Leben ist raus; bei dem Beispiel mit der Pflanze war auch ein „Nichts“, und auf einmal kommt eine Blüte. Bedeutet dies, dass das Leben den Tod als Voraussetzung hat?
eine Engführung, wo für einen Moment alles, was Summe der gesamten Lebensprozesse ist, in einem Punkt implodiert
T. Tritschel: Das istbeispielsweise bei den Verwesungsprozessen ganz real so: Der Boden, auf dem die Pflanzen wachsen, waren früher andere Pflanzen. Das ist auch wie eine Art Voraussetzung dafür. Aber an der Stelle, wo es eine radikale Umstülpung durch einen Todespunkt gibt, hat das einen anderen Charakter. Ich glaube nicht, dass es eine Art Automatismus gibt, d. h. es kommt nach jedem Todespunkt überall eine Blüte hervor. Das ist ja nicht immer so! Das ist eine sehr riskante Angelegenheit.
Es gibt zwei Arten mit dem eigenen kommenden Tod umzugehen: Entweder will ich lieber davon nichts wissen, blende ihn aus oder bagatellisiere ihn „Das ist ja bedeutungslos, man geht nur über die Schwelle“ oder so. Eine Türschwelle ist ja nur 3 cm hoch, und ich glaube, beim Tod quetscht man sich wirklich durch eine Art Nadelöhr; man macht nicht nur einen Schritt und ist dann im nächsten „Existenzraum“. Ich glaube, es ist vielmehr eine Engführung, wo für einen Moment alles, was Summe dieser gesamten Lebensprozesse ist, in einem Punkt implodiert, in einem „Nichts“. Und ob das die Kraft hat, auf der anderen Seite, als was auch immer, in Erscheinung zu treten, ist ein riskantes Manöver.
C. P.: Das kann man ja auch nicht wissen ….
T. Tritschel: In bezug auf den Tod am Ende meines Lebens weiß ich das nicht, aber man kann das sehr gut an solchen Sterbeprozessen innerhalb des Lebens, mit denen man zu tun hat, beobachten. Eine totale Depression, die man innerhalb des Lebens halten will und die nicht bis zum Tod führt, trägt hinterher nicht automatisch Früchte.
C. P.: Gilt das auch für Krankheiten?
Es kann eben auch sein, dass etwas aus der Evolution herausfällt
T. Tritschel: Bei Kinderkrankheiten mag noch zutreffen: Wenn ein Kind die Masern hatte, verwandelt es sich schon irgendwie, das „geschieht“ noch. Aber bei den Sterbeprozessen, bei denen wir aktiver beteiligt sind, ist das kein Automatismus. Man kann nicht sagen: „Jetzt machen wir es mal richtig hart und was uns nicht umbringt, macht uns stark.“ Es kann eben auch sein, dass etwas aus der Evolution herausfällt, brach liegt und kaum noch brauchbar ist für weitere Entwicklungen, wirklich zerstört wird.
C. P.: Wenn man sich bei vollem Bewusstsein auf diesen Punkt zubewegt, ist das ja auch nicht ohne: Man hat die größten Ängste, die es gibt. Vor was genau hat man dann Angst?
T. Tritschel: Vor der Enge. Angst kommt von Enge. Das liegt schon im Wort. Extreme Verengung führt zum „Punkt“, d. h. durch eine Art Zusammenpressung. Man könnte sagen: Angst ist per se Klaustrophobie, im Sinne von Enge; man sieht, die Leitplanken laufen auf einen Punkt zu und ich kann da nicht mehr ausbrechen. Das ist, wie wenn die Kühe auf den Schlachtplatz zulaufen und nur noch eine durch das Gatter passt und dahinter steht jemand mit dem Bolzenschussgerät.
Angst ist, wenn man trotzdem Angst hat
Ich habe dabei den Eindruck, dass es nicht eine Angst „vor etwas“ ist; die existenziellsten Ängste sind nicht Ängste „wovor“, sie suchen sich lediglich ein Objekt, einen Anlass. Angst ist für meine Begriffe eine existenzielle Grundtatsache, Grundempfindung, die bei jedem darunter liegt. Ich habe noch nie jemandem geglaubt, dass er angstfrei sei. Entweder ist er dumm, lügt, oder ist nicht konsequent genug in der Frage, in welcher Schicht er sie hat. Ich würde sagen, dass ich nicht wirklich Angst vor dem Tode habe, aber vor dem Sterben; ich leide mitnichten gerne … wer tut das schon? Natürlich macht auch das Angst, was ich kenne. Wenn ich weiß, ich stehe vor einem Löwen, dann habe ich eine berechtigte Angst, dass er mich fressen könnte – das weiß ich. Aber am meisten Angst entsteht vor dem was wir nicht wissen, nicht kennen. Nichtwissen und Nichtkennen aber sind Grundsituationen unseres Seins, ja geradezu konstitutiv. Angst ist, wenn man trotzdem Angst hat. Das ist ein Paradoxon. Schon merkwürdig, oder?
C. P.: Sie sagen, es sei kein Automatismus, dass aus einem Todespunkt etwas Neues entsteht und dass die Möglichkeit besteht, aus der Evolution herauszufallen. Andererseits ist es eine Notwendigkeit im Leben, diese Sterbeprozesse immer wieder zu vollziehen. Und müsste man nicht auch sagen, dass man sie aufsuchen muss, wenn man in der Evolution drinnen bleiben will? Gerade wenn ich schöpferisch etwas Neues hervorbringen möchte, muss ich sie doch aktiv wollen?
Es gibt keinen Schöpfungs-prozess, welcher Art auch immer, der ohne Todespunkte funktioniert
T. Tritschel: Es gibt keinen Schöpfungsprozess, welcher Art auch immer, der ohne Todespunkte funktioniert. Im Physischen wäre das einfach nur eine Wucherung, wenn nur diese eine Seite „Wachstum ohne Ende“ vorhanden ist. Das bezieht sich beispielsweise auch auf diese idiotische Auffassung, die wir von der Wirtschaft haben: ständiges Wachstum. Jeder, der organische Prozesse beobachtet, könnte von vorneherein sagen, dass das gar nicht gehen kann, es muss Abbauprozesse geben, damit es weiter gehen kann. Ohne die funktioniert überhaupt nichts.
Das muss ich „töten“, um den Raum zu schaffen, damit das, was entstehen will, überhaupt Platz hat
C. P.: Und wie macht man das – diesen Todespunkt aufsuchen?
T. Tritschel: Picasso sagte einmal: Ich suche nicht, ich finde. Wenn ich tatsächlich in einem schöpferischen Prozess bin, muss ich diese Stellen, wo das nötig wird, nicht künstlich suchen. Die sind da und zeigen sich. Die Frage ist, ob ich die nötige Aufmerksamkeit und das nötige Bewusstsein dafür habe, sie zu bemerken, um zu sehen: Das muss ich jetzt zerstören, das muss ich „töten“, um den Raum zu schaffen, damit das, was entstehen will, überhaupt Platz hat und in Erscheinung treten kann. Das ist bei jedem Bild so. Wenn man beispielsweise merkt, dass man eine Linie gemalt hat, die ganz gut gelungen scheint, ist schon vorherzusehen, dass sie zugunsten des Gesamtbildes übermalt werden muss. Man weiß: Die muss ich opfern, dann geht wieder was. Wenn man sie so lange wie möglich halten will, ist das dieser Konservativismus „es ist doch so schön, es könnte doch bleiben“. Aber genau das geht eben nicht, man muss es aufgeben und transformieren. Wenn nicht, dann geht es sowieso seinen natürlichen Gang dem Ende entgegen.
C. P.: Wenn man Todesprozesse bemerken will, ist das Künstlerische also eine Art Urbild. Und es stünde an, dass wir diese Transformation im Wirtschaftsleben und im Sozialen vollziehen – was wir aber nicht machen?!
Es wird Wärme frei, was damit auch eine Willensqualität ist
T. Tritschel: Die finden zwar statt, aber wir bekommen sie für die Entwicklung nicht produktiv. Diese beschriebenen Zerfallsprozesse sind ja immer Verbrennungsvorgänge, in ihnen wird Wärme frei, was damit auch eine Willensqualität ist, die aber nicht nutzbar wird, wenn ich sie nicht bemerke. Dort, wo etwas zerfällt, entsteht auch etwas – das ist eine simple Angelegenheit. Wenn ich ein Stück Holz verbrenne, entsteht Wärme und Licht. Wenn ich das aber nicht mitbekomme und nicht nutze, dient das höchstens der Entropie, wird aber nicht produktiv gemacht.
Wie viele es braucht, um etwas in Gang zu setzen, ist eine rätselhafte Angelegenheit.
C. P: Um es konkret zu machen: Im Wirtschaftlichen sind wir an solch einem Todespunkt, und es gibt Erneuerungsimpulse wie z. B. Grundeinkommen, was sich aber gesamtgesellschaftlich nicht durchsetzt. Wäre das ein Beispiel dafür?
T. Tritschel: Ich möchte nicht, dass es einen Duktus bekommt von „man müsste mal, wir sollten doch alle…“. Das hat keinen Wert. Wie viele es braucht, um etwas in Gang zu setzen, ist eine rätselhafte Angelegenheit. Auch Rudolf Steiner spricht von „der genügend großen Anzahl“ – aber wie viele sind das? Sind das 5, 10 Leute? Wenn ich mich an Leipzig erinnere, waren es 2.000 Menschen, die an einem Tag einfach losgerannt sind; und innerhalb kürzester Zeit waren es 200.000. Eine bestimmte Menge ist nicht nur eine Quantität, sondern auch eine Qualität: Es passiert eine Art Umschlag, eine Dynamik, die etwas in einem größerem Stil in Gang bringt. Aber es ist ein Rätsel, wann dieser Umschlagpunkt erreicht ist.
Wenn so eine Idee auftaucht, gibt es hinterher eine Phase, in der sie nochmal restlos verschwindet. Aber es ist nicht weg!
Ich bin insofern nicht so pessimistisch und ungeduldig, dass das beispielsweise mit dem Grundeinkommen schnell passieren muss. Ich habe immer wieder erlebt: Wenn so eine Idee auftaucht, gibt es hinterher eine Phase, in der das nochmal restlos verschwindet. Aber es ist nicht weg! Ich bin nicht sicher, ob das eine Gesetzmäßigkeit ist, aber irgendwann tauchen solche Impulse wieder auf; es geht in eine andere Schicht und bekommt dort noch mal eine andere Dynamik. Die Idee „Grundeinkommen“ hat eine große Komplexität und Vitalität – und das ist eine geistige Realität, die nicht wieder wegzukriegen ist, auch wenn es nicht gleich bis zur auszahlbaren Realität kommt. Aber mit Blick auf die Schweizer Freunde bin ich z.Z. ganz zuversichtlich, dass es weitergeht.
Wir würden ähnlich linear in den Kategorien denken wie die derzeitige Wirtschaft, für die nur fortlaufendes Wachstum, Schaffung von immer mehr Arbeitsplätzen etc. der Maßstab ist. Stattdessen taucht etwas auf, stirbt wieder ab; taucht wieder auf, entwickelt sich weiter. Solche Phasen gehören dazu.
„Nur Kunst kann verändern.“
C. P.: Sie sagen, diese Sterbeprozesse finden statt, und es ist eine Frage der Aufmerksamkeit, sie zu erkennen. Wie kann man einerseits diese Aufmerksamkeit schulen, und wie kann man andererseits üben, das dann auszuhalten, denn Todesprozesse muss man auch ertragen können?
T. Tritschel: In einem Interview wurde Joseph Beuys gefragt: „Sie haben behauptet, Kunst kann auch das Leben und die Gesellschaft verändern.“ Darauf Beuys: „Nein. Nur Kunst kann verändern.“ Ich glaube das wirklich: diese Schulung – das ist Kunst. Alles, was wir an Kunst kennen, dient eigentlich nichts anderem, nicht der Dekoration, der Erbauung oder was auch immer. Es wird ein Empfinden geschult für die Stimmigkeit in allen Bereichen. Das Musikalische ist beispielsweise das eigentliche Übungsfeld für Rechtsgestaltungen; da lernen wir, uns abzustimmen, einzustimmen.
Das geht nur in einem Übungsprozess
Dazu gehören auch die Prozesse, die mit dem Sterben zu tun haben, aber das kann man nicht in einer Wissensschicht vermitteln und in einem Katalog das Gelernte abhaken. Das geht nur in einem Übungsprozess, in dem ich immer wieder damit umgehe und nach und nach eine Empfindung dafür entwickle. Ich kann niemanden erklären, warum beispielsweise auf einem Bild ein schwarzer Klecks hin muss, ich muss es herausfinden.
C. P.: … oder indem man die Lieblingsstelle übermalt!?
T. Tritschel: Ja, durchaus. Aber das ist ja noch etwas relativ Leichtes. Ich will jetzt nicht über Menschen sprechen, die wirklich schwerstes Leid ertragen, was ich in der westlichen Gesellschaft nie ertragen musste. Es wäre Hohn, so leichthin darüber zu sprechen, was manche Menschen ertragen müssen. Ich kann darüber reden, wo ich meine kleinen Tode ertragen lerne, und in der Kunst ist das vergleichsweise machbar. Das, was wir gemeinhin Kunst nennen, ist ja noch dieses Übungsfeld – ernst wird das Ganze erst in einem „Erweiterten Kunstbegriff“, der tatsächlich das Leben als Ganzes umfasst.
Ich glaube auch nicht, dass es eine feststehende Methodik gibt. Die erfahre ich erst, wenn ich an diesem Punkt stehe. Die gibt es nicht vorher. Die ist hoch individuell. Das einzige, was ich anstreben kann, ist, an dieser Stelle nicht gänzlich das Bewusstsein zu verlieren – die besagte Aufmerksamkeit.
Ostern
Da sind wir bei Ostern. Wie finde ich den Christus? Ich finde ihn nur an dieser Stelle der Ohnmacht, wo ich nichts mehr kann, es keine Hintertür mehr gibt. Da begegne ich dem Schöpfer, der diesen Moment produktiv machen kann. Wie dieses Wesen an dieser Stelle ist, kann ich vorher gar nicht wissen.
C. P.: … und wie ich dann selbst bin, weiß ich auch nicht.
Ich weiß nicht, wie ich bin, wenn ich aufs Sterben zugehe
T. Tritschel: Das werde ich erfahren, wenn ich an dieser Stelle bin. Ich kann mir das Beste, bzw. diese besagte Aufmerksamkeit wünschen, aber ich weiß nicht, wie ich bin, wenn ich aufs Sterben zugehe – unflätig, ein herrischer Knochen oder was auch immer.
C. P.: Das gilt ja nicht nur für große Lebenssituationen, sondern auch für ganz alltägliche. Wenn man sich überfordert fühlt, weicht man auch aus, indem man sich vor den Fernseher setzt, raucht, ins Fußballstadion geht, shoppen oder was auch immer. Und die Aufmerksamkeit ist damit zugedeckt.
„Morgen gehen wir wieder an die Arbeit, aber jetzt lassen wir es mal richtig krachen.“
T. Tritschel: Ich finde es nicht schlimm, dass man das mal macht – da hat jeder seine Technik. Aber ich brauche eine Aufmerksamkeit, dass ich das gerade mache, und es zeitlich begrenze, d. h. damit umgehe. Manchen Menschen würde ich wünschen, dass sie sich mehr solche Stellen gönnen „Jetzt ist alles wurscht, morgen gehen wir wieder an die Arbeit, aber jetzt lassen wir es mal richtig krachen.“ Diese hartleibige, humorlose Konzentriertheit auf das, was wichtig ist, ist auch nicht produktiv. Man sollte ruhig mal ins Fußballstadion gehen und für Schalke brüllen – danach kann man wieder weitermachen. Das ist auch eine Frage des gesunden Rhythmus.