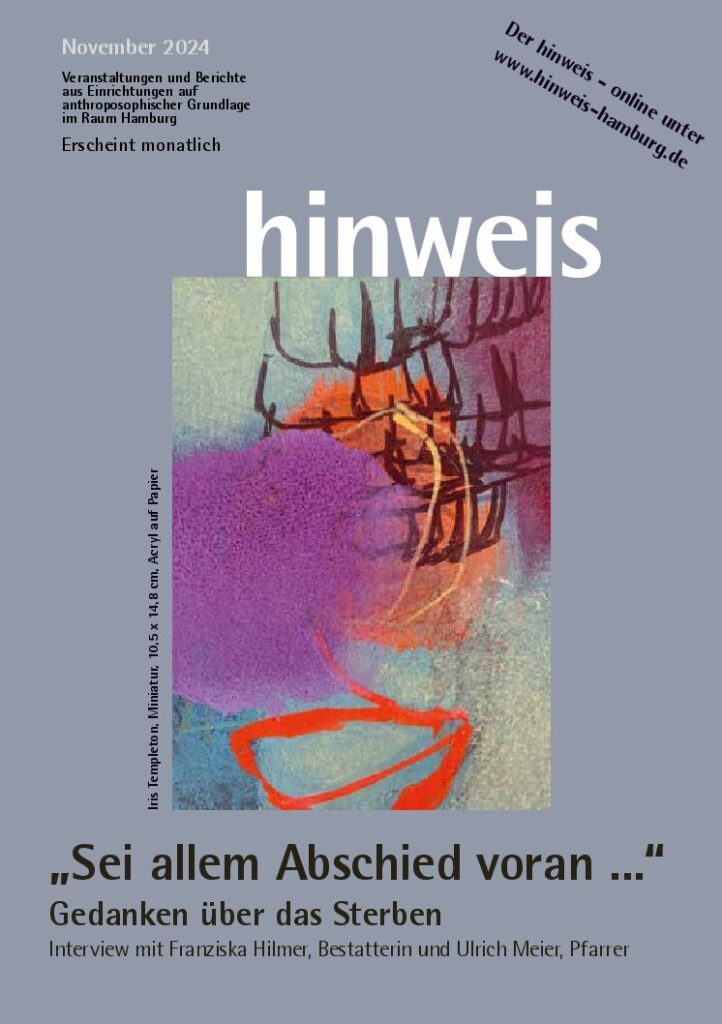Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
DER HINWEIS-DIALOG: Ehe – mit Ritualen, Segen oder Sakrament? Teil I und II
Gespräch mit Engelbert Fischer, Pfarrer der Christengemeinschaft und Jürgen Wisch, evangelischer Pastor


Der Frühling kommt und es naht der Wonnemonat Mai – traditionell eine Zeit, in der Paare heiraten. Aber warum sollte man das tun? Oder warum kann man es tun? … zumal heute eine bunte Palette an Lebensformen zwischen Partnern möglich ist.
Trotzdem haben Menschen immer wieder den Wunsch – mehr oder weniger klar – ihrer Partnerschaft eine religiöse Dimension hinzuzufügen.
Wie ist diese spirituelle Tat einer Eheschließung zu sehen? Welche Möglichkeiten gibt es dafür? Wie streng sollte man das handhaben oder wie weit den aktuellen Verhältnissen entgegen kommen? In welchem Kontext steht die Ehe als Sakrament in der Christengemeinschaft oder als Kasualie – Kirche bei Gelegenheit – in der evangelischen Landeskirche? Das alles sind bewegende Fragen, nicht nur für Frau und Mann, sondern auch für die Kirchen und die Pfarrer selbst.
Interviewpartner: Jürgen Wisch, evangelischer Pastor seit 26 Jahren, die letzten 7 Jahre Gemeindepastor in HH-Steilshoop; seit Februar diesen Jahres Pastor für das Projekt „Kirche bei Gelegenheit“ es geht dabei um die Intensivierung des Kontaktes zu dem großen Teil der Kirchenmitglieder, die vor allem bei biografischen Gelegenheiten, wie Taufe, Trauung und Beerdigung den Kontakt zur Kirche suchen. Er wohnt in Ammersbek und ist mit dieser Projektstelle für die Gemeinden in Hoisbüttel, Bergstedt und Volksdorf zuständig. Verheiratet, 2 erwachsene Töchter.
Engelbert Fischer: seit fast 40 Jahren als Priester der Christengemeinschaft tätig; davon 12 Jahre in Wuppertal, 27 Jahre in Lübeck. „Wir haben in Lübeck eine relativ stabile Mitgliederzahl von 200 Menschen; in meinem Gemüte habe ich etwa 800 Leute. Wir sehen die Mitgliedschaft als einen Bekenntnisschritt also relativ streng. Auf die Mitglieder wollen wir uns verlassen können.“
In den letzten Jahren war er mit Lehr- und Leitungsaufgaben im Hamburger Priesterseminar betraut gewesen, inzwischen ist er wieder ganz als Gemeindepfarrer tätig. Verheiratet, 4 erwachsene Kinder
Christine Pflug: Herr Wisch, wie kam es dazu, dass die evangelische Kirche extra eine Projektstelle für Kasualien, d. h. „Kirche bei Gelegenheit“ einrichtet (Wikipedia: Kasualie oder Amtshandlung ist eine kirchliche Zeremonie, Handlung oder Veranstaltung, die von einem Pfarrer für bestimmte Einzelpersonen oder Gruppen durchgeführt wird. Das Wort ist abgeleitet von lat. casus „Fall“, d. h. die Kasualie wird „im Einzelfall“ bzw. „bei Bedarf“ ausgeführt. Es sind dieses im Besonderen: Taufe, Heirat (Hochzeit), Beerdigung (Bestattung), Konfirmation oder Traujubiläen. Anm. d. Red.)?
Jürgen Wisch: Ein stabiler Prozentsatz von ca. 70% Mitglieder der evangelischen Kirche wollen laut kirchensoziologischen Studien nicht mehr als das. Sie sagen z.B.„Gemeinschaft suche ich nicht in der Kirche, aber gute Sozialarbeit und für mich persönlich möchte ich, dass die Kirche mich an bestimmten biografischen Gelegenheiten begleitet.“, d. h. man will bei Übergängen wie Taufe, einem Trauerfall, Heirat kompetente und gute Gespräche haben und einen sinnstiftenden, die Situation symbolisch aufnehmenden Ritus feiern. Dieses Projekt ist auf eine fünfjährige Laufzeit angelegt. Es geht darum, wie wir als Kirche auf diese Wünsche reagieren und wie wir das positiv bewerten können. Diese Projektstelle soll einen positiven Umgang mit diesen Menschen fördern: wie heißen wir sie willkommen? Wie nehmen wir sie positiv auf? Wie stellen wir uns auf ihre besondere, einmalige Situation ein? Ich habe jetzt, anders als die Kollegen im normalen Gemeindealltag, die Chance, mich theologisch und soziologisch mit den Themen dieser Menschen zu beschäftigen.
wir brauchen heute auch noch ganz andere Gelegenheiten als die klassischen Kasualien
Mit dieser Stelle soll auch nach außen geworben werden: dass Kirche sich beweglich zeigt, dass wir heute auch noch ganz andere Gelegenheiten brauchen als die der klassischen Kasualien, beispielsweise wenn Menschen in den Ruhestand eintreten, Angebote für Menschen in der Lebensmitte – welche Kontakte, Rituale, theologischen Möglichkeiten können wir für diese Fälle anbieten?
Natürlich kann die Kirche in ihrem Leben nicht von diesen 70% Mitgliedern getragen werden, das geschieht durch die, die sich regelmäßig beteiligen und sich ehrenamtlich engagieren. Aber man muss einfach auch sehen, dass sie relativ stabil Kirchensteuer bezahlen und sich zu Recht zugehörig fühlen. In diesem System der „Volkskirche“ müssen wir uns mit diesen beiden Formen der Mitgliedschaft arrangieren. Das ist anders als in freien Kirchen.
die Menschen in ihrer besonderen Lebenssituation wahrnehmen
C. P.: Wie definieren Sie „kirchliche Amtshandlungen“?
J. Wisch: Grundsätzlich finde ich das ein schwieriges Wort, weil es nach Obrigkeitskirche klingt. Ich würde es lieber „Kirche bei Gelegenheit“ nennen. Es handelt sich um kirchliche Segenshandlungen zu bestimmten biografischen Übergangssituationen – die klassischen sind Taufe, Konfirmation, Trauung und Bestattungen. Unter Pastoren nennt man das Kasualien, was ich eigentlich den treffenderen Begriff finde, weil es eigene, persönliche biografische „Fälle“ sind. Es geht nicht darum eine Amtshandlung „abzuspulen“, sondern die Menschen in ihrer besonderen Lebenssituation wahrzunehmen und eine deutende Beziehung herzustellen zwischen ihrem erzählten Leben und dem erzählten Glauben in der Bibel. In diesem Sinne gehört immer ein ausführliches Gespräch dazu, egal ob es sich um Taufe, Trauung, Beerdigung handelt. Für die eigentliche Feier suche ich nach einem Bibeltext, der zur Sprache bringt, was das Leben dieses betreffenden Menschen oder das Bild der Eltern über ihr Kind oder die Vorstellung des Paares über ihre gemeinsame Ehe oder bei der Bestattung das vollendete Leben ausmacht.
Engelbert Fischer: Wie wird der Sakramentsbegriff heute theologisch gesehen?
J. Wisch: Die klassischen sieben Sakramente sind von Luther begrenzt worden auf zwei oder drei; man kann diskutieren, ob die Buße auch dazu gehört, das ist die Beichte mit dem dazugehörigen Akt der Sündenvergebung. Luther hat Sakrament so definiert, dass zwei Dinge zusammenkommen: es ist eine von Christus selber eingesetzte Handlung, bzw. kommt in der Bibel vor; deshalb hat er die Priesterweihe, Krankensalbung etc. davon ausgenommen. Als zweites muss ein „greifbares“ Element dazu treten. Das ist bei der Taufe das Wasser und beim Abendmahl Brot und Wein. Beim Bußsakrament könnte die Handauflegung als der leibliche Teil angesehen werden. Die Eheschließung ist deshalb in der Evangelischen Kirche ganz bewusst kein Sakrament.
… dass unmittelbare Christusgegenwart hereinwirken kann für das, was man biografisch vorhat
C. P.: Was ist ein Sakrament im Sinne der Christengemeinschaft?
E. Fischer: Vorab möchte ich sagen, dass ich hier für mich spreche und nicht als Vertreter “Der Christengemeinschaft“. Wir haben keine Lehrmeinung, wir sind auf nichts „eingeschworen“, auch nicht auf die Anthroposophie. Unsere Verbindlichkeit ist das Neue Testament und das Leben mit dem Kultus. Dem dürfen wir allerdings nicht „zuwiderpredigen“.
Wir verwalten sieben Sakramente, die an den Bruchzonen der Biografie wirksam werden können: nach der Geburt, wenn man erwachsen wird, wenn man eine Partnerschaft begründet. Aber auch, wenn man durch das Schicksal in Abbrüche kommt: man wird z. B. von der Firma gekündigt und ist plötzlich arbeitslos oder man war das Leben lang workoholic und kommt jetzt in Rente, oder andere Schicksalsdramen. Da kann das Beichtsakrament in Anspruch genommen werden, dem eine Schicksalsberatung vorausgehen kann.
Wenn sich jemand zum Gottesdiener machen will, gibt es die Priesterweihe. Wenn es wirklich zum Sterben kommt, wird die Sterbeölung – ganz bewusst nicht Krankensalbung – vollzogen.
Ich kann mit Luther gut einhergehen, wenn er sagt, dass Abendmahl ist das Ursakrament, d. h. die Wegzehrung, wenn man Christ werden will, was ja ein Weg ist.
Es gibt in der Biografie Stufen, die zur Kommunion führen, und es gibt Folgen und Konsequenzen. Wenn man sich in der Kommunion zu einer Verbindlichkeit mit dem Christus entschlossen hat, dann kann auch eine Partnerschaft oder das Sterben eine zusätzliche Qualität gewinnen, wenn man die dazu nötige Wegzehrung erhält.
Diese „Wegzehrung“ gibt es in verschiedener „Kostform“: kleine Kinder brauchen etwas anderes als Heranwachsende, und bei der Suche nach einer neuen Schicksalsorientierung ist das auch noch mal anders.
Ich verstehe Sakrament so, dass in Wort und Zeichen in verschiedener Gestaltung unmittelbare Christusgegenwart hereinwirken kann für das, was man biografisch vorhat.
Beichte bedeutet nicht wie im katholischen Sinne, dass man seine Sünden darstellt, sondern dass man auf die Biografie gemeinsam hinschaut und das „bei Lichte“ besieht. Dazu kann dann ein Christus-Wort wegweisend hinzutreten. Das sind Berührungen mit dem Göttlichen in sich selbst. Das Beichtsakrament muss man frei suchen, es gibt dafür keine festen Gelegenheiten.
J. Wisch: Dem kann ich zustimmen, wobei ich eher das Wort sakramental benutzen würde. In der theologischen Tradition, in der ich stehe, gab es eine historische Grenzziehung gegenüber der katholischen Kirche, in der Sakramente ein starkes Eigenleben mit der damals dazugehörigen Gesetzlichkeit entwickelt haben. Für mich ist es so, dass die Sakramente das sind, was sich auf Jesus Christus selbst begründet, aber natürlich sind es auch Möglichkeiten des Zusammenspiels zwischen der göttlichen und der menschlichen Wirklichkeit. In der orthodoxen Kirche beispielsweise gibt es eine viel freiere Auslegung: das Wort des Sakramentalen wird ganz grundsätzlich als Haltung des Christen in der Welt verstanden.
C. P.: Sie haben bei einer sakramentalen Handlung die Freiheit einer Gestaltung, z. B. mit Ritualen, dem Lesen von Texten oder was auch immer passt?
J. Wisch: Ja.
E. Fischer: Gibt es dabei Elemente sine qua non, die also unbedingt zur Gestaltung dazugehören?
J. Wisch: Das gibt es bei Taufe und Abendmahl, aber bei den anderen Handlungen nicht. Das sage ich jetzt als Privatperson. Natürlich gibt es kirchliche Regelungen, wie eine Trauung oder Beerdigung abzulaufen hat, aber auch da hat sich in den letzten 15 Jahren einiges gewandelt: Es gibt nicht mehr die eine „Agende“ für unseren Gottesdienstablauf, sondern in dem jetzigen Gottesdienstbuch wird eine Grundform beschrieben mit einigen Elementen, die zum Gottesdienst dazugehören müssen. Aber darin gibt es eine relative Freiheit der Gestaltung; Das betrifft genauso die Kasualien, also Bestattung und Trauung. Natürlich gehört das Traubekenntnis und das „Ja-sagen“ dazu, genauso eine biblische Lesung, ein eröffnendes Gebet und der Segen für das Paar.
C. P.: Es gibt in Bezug auf Partnerschaft heute eine bunte Palette von Lebensformen, beispielsweise in getrennten Wohnungen leben, manche wollen bewusst nur einen „Abschnittsgefährten“ usw. Auch zeigt sich eine Tendenz, dass man für eine Eheschließung selbst Rituale sucht und kreiert, mit spirituellen Elementen, aber außerhalb der kirchlichen Institution. Was ist für Sie der Unterschied zu einer kirchlichen Trauung?
J. Wisch: Für mich ist der Unterschied, dass ich einen klaren Bezugsrahmen herstelle. Wenn ich eine Trauung mache, bin ich zwar bereit, bestimmte Schritte der Gestaltung mit dem Brautpaar frei zu entwickeln, aber es wäre als ein Grundprinzip eine Lebensdeutung mit biblischem Zusammenhang dabei. Als zweites wäre in irgendeiner Form das Gebet dabei, d. h. das Gespräch mit Gott muss dabei Platz haben. Als drittes würde ich mit dem Brautpaar über das Bild von Partnerschaft sprechen und darin kommen christliche Grundlagen zur Sprache, beispielsweise, dass sich die Paare gegenseitig anerkennen als Ebenbild Gottes. Eigenständigkeit und Gleichberechtigung, Vergebungsbereitschaft, Verantwortung für die Schöpfung sind Werte, über die ich mit dem Paar ins Gespräch komme. Diese Werte spielen in der Gestaltung des Rituals auch eine Rolle.
Beispielsweise begegnet mir manchmal der Wunsch – das kommt aus amerikanischen Spielfilmen -, dass die Braut vom Vater dem Bräutigam zugeführt werden möchte. Die Leute wollen das unbedingt, weil sie es aus dem Fernsehen kennen. Dieses Ritual hat keinen christlichen Hintergrund, es ist eine ganz alte archaische Tradition, dass die Braut vom Besitz der Familie in den Besitz des Bräutigams übergeben wird. Und ich thematisiere das regelmäßig als Problematik: „Entspricht das Ihrem Verständnis von Partnerschaft, wenn Sie diesen Ritus vollziehen?“
der Pfarrer als „Fachmann für Symbole“
C. P.: Und wollen sie es dann immer noch?
J. Wisch: Manche ja, manche fangen an nachzudenken. An so einem Beispiel wird deutlich, dass bei „selbstgestrickten“ Ritualen manchmal etwas herauskommt, was die Leute im Prinzip nicht wollen und welche Berechtigung der Pfarrer als „Fachmann für Symbole“ hat.
E. Fischer: Es wird dabei ein Ritual und Symbol auch „entwichtigt“, weil es keinen Inhalt hat und es sich unter Umständen am Rande der Unwahrhaftigkeit bewegt.
In der sakramentalen Handlung der Christengemeinschaft werden die Rituale nicht selber gestaltet. Um das mit einem Beispiel deutlich zu machen: Eine ehemalige Konfirmandin aus unserer Gemeinde und ein kurdischer Moslem wollten heiraten und ich habe sie beraten, wie wir das machen könnten. Der muslimische junge Mann wollte keine christliche Trauung. Die junge Frau wollte keine muslimische Trauung. Wir haben dann gemeinsam erarbeitet, was eigentlich ihr beider Anliegen war. Sie wollten, und das finde ich ganz wunderbar, eine Art drittes Bekenntnis – ihr eigenes, gemeinsames – leisten; also nicht nur sie beide in Gegenseitigkeit, nicht nur ihrer sozialen Mitwelt gegenüber, sondern sie wollten ihren Willen auch vor Gott hintragen in der ihnen möglichen Frömmigkeit. Wir haben darüber gesprochen, wie sie das gemeinsam und ehrlich machen können.
Für die Feier habe ich ihnen Vorschläge unterbreitet, wie sie ein Ritual gestalten könnten – was sie auch aufgenommen haben. Es war dann sehr schön, „wohl unter Linden“, draußen in der Natur. Ich habe ihnen dann als Privatperson eine Ansprache gehalten, mich aber quasi in meinem Beruf als Priester nicht daran beteiligt.
rechtliche Grundlage, kirchliches Amt und die Partnerschaft selbst haben sich in der Gegenwart getrennt
Ich mache so etwas ganz gerne und finde es auch gut, dass sich manches in der Gegenwart getrennt hat: rechtliche Grundlage, kirchliches Amt und die Partnerschaft selbst. Vor hundert Jahren war das alles noch miteinander vermischt. Heute haben die einzelnen Partien mehr Eindeutigkeit und mehr Bewusstsein, die Menschen sind freier in ihrer Entscheidung. Ist es eine Sache, die unsere Mitwelt angeht oder nicht? Oder geht es unsere Mitwelt an, aber der „liebe Gott“ hat dabei nichts zu suchen? Oder will man in diese Richtung einen Schritt tun?
Wir haben in der Christengemeinschaft nicht viele Trauungen, auch wenn die Menschen trotzdem heiraten. Vor einer Trauung haben die Menschen – mit Recht – eine gewisse Scheu, weil sie einen hohen Anspruch beinhaltet, den wir als Pfarrer auch gut vorbereiten müssen. Auch geben wir uns viel Mühe mit der Vorbereitung der Verwandtschaft, um falsche Erwartungen zu vermeiden.
J. Wisch: Wäre es bei Ihnen gar nicht denkbar, dass diese üblichen „Accessoires“, die die Menschen mit einer Trauung verbinden, benutzt werden?
die sakramentale Handlung ist sehr streng, in sich geschlossen und konzentriert
E. Fischer: Denkbar ist es schon, dass man vorher oder nachher auch ins Heitere gehende Dinge macht, den Stamm durchsägen o. ä. Aber die sakramentale Handlung ist sehr streng, in sich geschlossen und konzentriert, in der Form und in der Sprache. Außer der Ansprache, die darin vorkommt und auf die individuelle Situation eingehen darf und soll, ist nichts Spontanes oder selbst Gestaltetes vorgesehen.
die Ehe ist ein „weltlich Ding“
J. Wisch: Es ist in der evangelischen Kirche durchaus ein Problem, dass wir diese Eindeutigkeit nicht ganz so haben. Offiziell ist die Trauung kein Sakrament, sondern ein Gottesdienst anlässlich einer schon vollzogenen und gültigen Eheschließung, die auf dem Standesamt geschlossen wurde. In der Kirche feiern wir einen Kasual-Gottesdienst bezogen auf diese Personen und diese Situation, mit dem Ritus des Ringe-Tauschens und dem Trau-Versprechen. Das hat sich gewandelt, früher war das Trau-Versprechen – wie Sie schon sagten – auch das öffentlich-rechtliche Trauversprechen, das in der Kirche gegeben wurde. Ursprünglich fand es sogar vor der Kirche statt, weil es in den weltlichen Bereich gehörte und in der Kirche wurde dann die Segenshandlung vollzogen. Heute bedeutet dieses kirchliche Trauversprechen: „Wir wollen unsere Ehe vor Gott führen und verstanden wissen“; es ist nicht mehr die generelle Aussage, dass man sich lebenslang aneinander binden will. Diese Trennung kam mit der Abschaffung des Bündnisses von Thron und Altar, im Reichsdeputationshauptschluss. (Wikipedia: Der Reichsdeputationshauptschluss (Hauptschluss: „Abschlussbericht einer Reichsdeputation“) war das letzte wichtige Gesetz des Heiligen Römischen Reiches, verabschiedet auf der letzten Sitzung des Immerwährenden Reichstags am 25. Februar 1803 in Regensburg. Anm. d. Red.). Luther hat in seinem „Trau-Büchlein“ geschrieben, dass sie ein „weltlich Ding“ sei.
Nun geschieht es ja immer öfter, dass Paare kommen, von denen nur ein Partner in der Kirche ist. Es ist dann meistens die Frau, die einen Trau-Gottesdienst möchte und wir – das muss man für die Praxis unserer Kirche so sagen – vollziehen das dann in der Regel auch. Es wird dann Kirchen-juristisch unterschieden zwischen Trauung und einem Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung. Aber wenn man in die theologische Literatur schaut, wird immer wieder gesagt, dass die Trauung grundsätzlich auch nichts anders ist, als ein „Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung“. Trotzdem wird dieser Unterschied gemacht und es wird dann „herumgeeiert“, worin der Unterschied denn nun besteht, der aus kirchenrechtlicher Sicht zu machen ist zwischen einem Paar, wo beide Mitglieder sind und einem Paar, wo ein Partner nicht Mitglied ist. Ein Punkt, den ich wichtig finde, ist die Traufrage: ich kann von jemandem, der nicht mehr in der Kirche ist, nicht erwarten, dass er oder sie selbstverständlich sagt: „Ja, mit Gottes Hilfe“ oder dass er Bezüge zu Gott, die in der Traufrage enthalten sind, bejaht. Das ist dann Gegenstand des Gesprächs und ich mache das auch nicht so billig und sage: „Das kriegen wir schon hin“, sondern es muss thematisiert werden.
Wir sind dann immer wieder damit konfrontiert, dass sie Leute sagen: „Aber das hat doch nichts mit meinem Christ-sein zu tun.“
C. P.: Und was sagen Sie dann?
J. Wisch: Ich erwidere, dass die Kirche eine Gemeinschaft ist, die davon lebt, dass man seinen Teil dazu beiträgt, was diese Gemeinschaft leistet – an Begleitung, Ausbildung, Seelsorge, Sozialarbeit. Und der Betreffende hat durch seinen Austritt ausdrücklich erklärt, dass er diesem nicht mehr angehören will und das ist damit auch eine Aussage über sein Verständnis von Glauben.
C. P.: Und so jemand würden Sie dann nicht trauen?
J. Wisch: Das ist nicht das zwingende Ergebnis bei uns. Aber es muss Gegenstand des Gesprächs sein und ich muss es selbst verantworten, ob ich dann trotzdem einen Gottesdienst mit diesen Menschen feiere, oder ob ich sage:„Du hast dich so weit davon entfernt und ihr habt darüber auch kein gemeinsames Verständnis“, so dass ich das nicht kann.
Für mich ist es immer wichtig zu wissen, ob es einem der beiden Partner wirklich wichtig ist, und er nicht aus reiner Konvention in der Kirche heiraten will, dann bin ich auch bereiter, eine Trauung zu akzeptieren.
der Grund, dass sie ihre Partnerschaft in etwas gründen wollen, ist größer, als das, was sie dazu tun können
C. P.: Was ist die Palette der Wünsche und Gründe, warum die Menschen überhaupt kirchlich heiraten wollen? Wegen der Verwandtschaft, dem weißen Kleid, weil die Kirche so schön ist?
J. Wisch: Ich glaube schon, dass bei denen, die nicht mehr in der Kirche sind, diese äußeren Gründe eine relativ große Rolle spielen, aber das alleine würde sie nicht dazu bringen. Für die meisten ist der Grund, dass sie ihre Partnerschaft in etwas gründen wollen, was größer ist, als das, was sie dazu tun können. Das ist aber ganz schwer zu thematisieren. Es ist so, wie wenn man einen Konfirmanden fragt, warum er sich konfirmieren lassen will und er dann sagt: wegen der Geschenke. Es würde kein Jugendlicher in Kauf nehmen, wegen der Geschenke zwei Jahre lang in den Unterricht zu gehen. Da steckt in der Regel sehr viel mehr dahinter, aber das kann man ganz schwer formulieren. Und das ist bei der Trauung genau so. Deshalb finde ich die Traugespräche sehr viel schwieriger als die Tauf- oder Beerdigungsgespräche, Es braucht einen längeren Weg, um so viel Vertrauen aufzubauen, bis man über diese Dinge, die so schwer zu benennen sind, miteinander reden kann. Selbst die beide, die heiraten wollen, haben sich meistens darüber nie ausgetauscht. Bei den Trauungen, die ich während meiner Berufszeit vollzogen habe, bin ich sicher, dass in 80% – 90% aller Fälle ein spirituelles Anliegen dahinter stand.
Dabei spielt auch eine Rolle, dass es ein Akt des öffentlichen Bekenntnisses zueinander – und auch vor Gott – ist. Das thematisiere ich regelmäßig, indem ich am Beginn des Gottesdienstes einige Sätze sage, durch die die anwesende Traugemeinschaft als Gemeinde konstituiert wird.
E. Fischer: In der Praxis sind wir da ganz ähnlich, auch wir haben etliche Traugespräche zur Vorbereitung. Wer überhaupt danach fragt, hat einen spirituellen Anlass und will über die seelischen Möglichkeiten hinaus – Liebe, Treue, Verständnis etc. – eine andere Dimension seines Menschseins und auch für die Gemeinsamkeit fruchtbar werden lassen.
Die vorbereitenden Gespräche nehmen viel Zeit in Anspruch, weil wir mit dem Trauritual einen Griff vollziehen in die spirituelle Sphäre. Die Traufrage spricht von Entschlüssen, mit denen „wir in der Geistwelt wandeln“. In dieser Sphäre soll das gemeinsame Leben Wurzeln fassen. Das wird gewollt.
„Entschlüsse in der Geistwelt“
C. P.: Was bedeutet „Entschlüsse in der Geistwelt“?
E. Fischer: Es gibt Entschlüsse, beispielsweise wenn ich gegen die Wand klopfe, die keine große Rolle spielen. Dann gibt es Entschlüsse, die im Sozialen relevant sind. Und dann eben solche, die „über meinen Hutrand hinausragen“ – sie begründen Schicksal. Damit ist nicht nur gemeint, dass man hinnimmt, was kommt. Ob man eine Frau sehr nett findet, oder ob man sie heiratet, ist ein Unterschied. Dieser Entschluss zur Heirat soll völlig frei sein – darauf achten wir sehr – und nicht getroffen werden, weil man „musste“, nicht anders konnte etc.
C. P.: Eine Eheschließung aus Verliebtheit wäre dann auch nicht frei?
Verliebtheit
E. Fischer: Man kann ja gerne verliebt sein, aber deswegen sollte man nicht heiraten. Beispielsweise kam ein junges Paar, sie war 18 und er 19, völlig verliebt zu mir und sie wollten unbedingt getraut sein. Ich sagte ihnen, dass sie, wenn ich ihnen jetzt entgegen kommen würde, sie mir 3 Jahre später die Augen auskratzen würden. Das haben sie nicht geglaubt und waren stinksauer. Aber drei Jahre später waren sie dann in anderen Partnerschaften glücklich.
Das Trausakrament ist eine Angelegenheit, die eine neue Dimension von Gemeinsamkeit konstituiert, die man im Leben dann erst suchen muss. Ob es gelingt, weiß man nicht, aber es wird gewollt und gesucht mit diesem Partner. Es ist kein Versprechen „bis dass der Tod uns scheidet…“. Es wird nicht nach Lieb und Treu gefragt, die setzen wir voraus, aber: ob gewollt wird, aus dem Geistigen heraus diese Partnerschaft zu prägen – christlich zu prägen!
C. P.: Kann man so einen Entschluss – in Anbetracht der eigenen Unzulänglichkeiten – überhaupt verantworten?
E. Fischer: Man kann sich in diese eigene Dimension „aufrecken“ und dann so ehrlich wie möglich ja sagen. In diesem „Ja“ spricht sich das Allerinnerste aus, was ein Mensch haben kann – in dieser Silbe tritt es in Erscheinung, wird Kultus.
J. Wisch: . „Mit Gottes Hilfe“ – so sagt man das bei uns. Gehört es bei Ihnen auch zur Antwort dazu: „Ja, mit Gottes Hilfe?“
E. Fischer: Nein, aber es ist innere Voraussetzung.
Werden Ehen im Himmel geschlossen?
C. Pflug: Noch einmal zu den Worten „in der Geistwelt wandeln“. Geistwelt ist ja etwas Vorgeburtliches, wo ich beispielsweise die eigenen Eltern, mein Schicksalsweg etc. aussuche. Entscheide ich dort auch, welchen Partner ich aussuche? Werden, was man in diesem Sinne dann sagt, „die Ehen im Himmel geschlossen?“
E. Fischer: Nein, das werden sie nicht.
Zur Geistwelt ist zu sagen, dass wir in ihr nicht nur vor der Geburt „wandeln“, sondern auch während des Lebens, nur mehr oder weniger wach oder schlafend. Wenn man anerkennt, dass man vorgeburtlich schon Entschlüsse getroffen hat für das Erdenleben, dann gehört dazu, wem man im Leben begegnen wird oder auch begegnen muss. Aber was man aus der Begegnung macht, dass ist eigene Sache; wenn man seinem „Karma“ begegnet, muss man es nicht unbedingt heiraten – eher sogar nicht!
C. P.: Warum nicht?
E. Fischer: Weil das Gestaltungselement der Freiheit fehlt. Und auch die Beobachtung zeigt – manche sprechen von einem „karmischen Inzest“ – , dass das nicht zu einer gedeihlichen Beziehung führt. Vielleicht meint man, wie zwanghaft, diesem schönen Mädchen unbedingt begegnen zu müssen, und man will sie dann absolut heiraten, aber in Wirklichkeit hat man etwas ganz anderes mit ihr abzumachen.
Ehe ist keine Schicksalsfügung
C. P.: Also lieber jemand heiraten, mit dem man karmisch nichts zu tun hat?!
E. Fischer: Das ist in jedem Fall besser, weil mehr Freiheit ist. Natürlich bekommt man dann karmisch etwas miteinander zu tun.
Da schließt sich noch ein anderer Aspekt an: Ehe ist keine Naturangelegenheit, auch nicht im spirituellen Sinne, also keine Schicksalsfügung. Sie ist eine hohe Kulturaufgabe. Und da spielt der Bezug, nicht nur zur Kirche, sondern auch zu dem Christus selbst eine sehr starke Rolle.
C. P.: Welche Bestandteile hat die Trauung?
E. Fischer: Das sind die Frage und das Ja-Wort und damit ist die Trauung als solche schon passiert – das haben die Zwei dadurch vollzogen. Und der Priester deutet jetzt hin auf die Konsequenzen, die das hat: dass es von der geistigen Welt wahrgenommen wird. Und wenn es ins Leben kommen soll, geht es nur mit dem Christus – „mit Gottes Hilfe“.
Und wenn man das alles nicht will, dann sollte man es doch gerne lassen. Beispielsweise möchten manche Frauen gerne die Trauung und der Mann partout nicht. Dann helfe ich ihm und nicht ihr, dass wir nämlich eine andere Formen der Gestaltung finden, die individuell für die zwei passt.
J. Wisch: Bieten Sie solch einem Paar dann ein anderes Ritual an?
E. Fischer: Wir würden dann gemeinsam überlegen, wie wir das machen könnten. Aber das mache ich dann als Privatmensch. Wenn sie die Trauung in der Christengemeinschaft wollen, bin ich sehr streng und mache mir damit auch manchmal Ärger.
C. P.: Wenn sie jetzt sagen, dass schafft man nur mit Hilfe des Christus – was heißt das?
E. Fischer: Die Grundvoraussetzung ist, dass sie sich gegenseitig in ihrer Würde akzeptieren. Ich rate dann auch, dass es z. B. genügen kann, einmal am Tag – versuchsweise – mit den Augen Gottes auf den Partner zu schauen. Auch wenn man sich gestritten hat oder der Haussegen schief hängt – einmal für einen kurzen Moment diesen ganzen Kram zur Seite stellen und überlegen: Wie will ich denn von Gott angeschaut werden? Und dann versuchen, so auf den Partner zu blicken. Dann den Vorhang wieder zumachen. Dann kann man sich ja weiter streiten …
C. P.: Es gibt im Trausakrament eine Formulierung über die Rolle der Frau und die Rolle des Mannes, die sich sehr „verfänglich“ anhört. Was ist damit wirklich gemeint?
er soll ihr voranleuchten und die Frau soll ihm folgen
E. Fischer: Es werden dem Mann und der Frau unterschiedliche Aufgaben zugewiesen. Die Formulierung für den Mann lautet: er soll ihr (der Frau) voranleuchten und die Frau soll ihm (dem Manne) folgen. Wenn man das hört, gehen ja meist alle emanzipatorischen Stacheln hoch und man sieht das letzte Jahrhundert aufmarschieren! Fast jeder meint zu hören: er soll führen und sie soll folgen! Davon ist aber gar nicht die Rede, sondern von „voranleuchten“. Mit dem Licht soll er leuchten, dass „der wiedererstandene Christus in seinem Geiste leuchten lässt“. Weiß der Mann überhaupt, dass in seinem Geiste Licht leuchten kann? Es ist nicht das persönliche Licht – „ich leuchte“ -, sondern der wiedererstandene Christus ist das Leuchten, wenn man es zulässt. Und: der wiedererstandene Christus ist durch den Tod gegangen! Wenn ich in meinem persönlichen Dominanzbedürfnis meiner Partnerin vorangehe, ist von Tod oder Verzicht keine Rede und es leuchtet auch nichts im Geistigen, sondern spielt sich nur im Seelischen ab.
Es heißt: „Die Seele sollte dem Lichte des Geistes folgen“. Dazu sagen die modernen Frauen manchmal: „ja, dazu brauche ich aber meinen Partner nicht. Mein Mann hat zwar viel Gemüt, aber da leuchtet wenig! Er ist eigentlich die bessere Hausfrau!“ … oder so ähnlich.
Das darf ja auch alles sein. Aber da, wo die eigene Seele nur dem eigenen Geiste folgt und das ins Leben bringt, ist das für die Partnerschaft noch nicht fruchtbar. Das ist einsam! Dann tritt der persönliche Weg in den Vordergrund.
Es geht darum, dass ein Paar das ins Gemeinsame einbeziehen will, d. h. das, was der Mann konstitutionell besser kann und das, was die Frau konstitutionell besser kann, für die Partnerschaft entwickelt. Die Frau gibt es nicht dem Mann und der Mann nicht der Frau, sondern beide für die Partnerschaft. Dabei muss natürlich jeder auch seinen eigenen Weg gehen und Orientierung suchen.
J. Wisch: Das leuchtet mir ein und ich finde es ganz spannend, aber müsste dann die Formulierung nicht doch für beide Partner gleich sein?! Warum wird es nicht gegenseitig als eine Aufforderung gesprochen, dass auch der Mann in dem Licht des Christus folgen solle, das die Frau ihm vorausleuchten lässt? Ich könnte schwer mit so einer tradierten Ritualformulierung leben, wenn ich nicht die Freiheit hätte, sie dem Verständnis der Partnerschaft in der Ehe anzupassen, also in voller Verantwortung das aufzunehmen, was drin steckt und es so neu zu formulieren, dass es dem heutigen Verständnis von Partnerschaft und der Rolle der Geschlechter entspricht.
E. Fischer: Da liegt eine Erkenntnisfrage vor, ob, wenn man ins Spirituelle geht, die Geschlechterspezifik auch weiterhin gilt. Da, wo ich ein freies Individuum bin, gibt es keine Unterschiede zwischen Mann und Frau. Aber wenn ich aus dieser Individualität heraus meine Konstitution in Kultur nehme, also die Frau kultiviert ihre weibliche und der Mann seine männliche Konstitution, tritt eine neue und individuelle Geschlechterspezifik auf. Das ist der Hintergrund dieser Formulierungen. Wir können nur kultivieren, was wir haben. Das richtet sich überhaupt nicht gegen die Emanzipation, im Gegenteil. Diese Erkenntnisfrage begleitet mich schon lange: Was heißt das, wenn ich als Mann mein Mann-Sein mit geistiger Unterstützung in Kultur nehme? Da muss doch etwas anderes dabei herauskommen, als wenn meine Frau ihr Frau-Sein in Kultur nimmt.
J. Wisch: Aber in beiden leuchtet doch das Licht des Christus?
das Frau-Sein und Mann-Sein im Spirituellen entwickeln
E. Fischer: Ja, in jedem Fall. Aber wenn man das für die Partnerschaft fruchtbar machen will, liegt darin eine Zukunftsperspektive. Wenn meine Seele meinem eigenen Geisteslichte folgt und meine Frau das für sich auch macht, ist das für die Partnerschaft nicht relevant. Auch wenn ich danach schiele, ob meine Frau mir voranleuchtet, tue ich nicht meine Arbeit in dem Sinne, wie ich sie in der sakramentalen Trauung zugesprochen bekomme.
Ich habe große Zukunftshoffnung, dass man sein Frau-Sein und Mann- Sein im Spirituellen entwickelt. Also nicht, wie man es oft hat, im Sinne einer Überwindung zum Gleichen: „das Geschlecht spielt jetzt keine Rolle mehr“ usw.
C. P.: Wenn man sich als Frau oder Mann in diesem Sinne eine Selbsterziehung auferlegt, ist das dann etwas Geschlechtsspezifisches, aber eben nicht mehr in dem subjektiv-persönlichen Sinne!?
Es wird aufs Neue etwas Geschlechtsspezifisches!
E. Fischer: Es geht über das Persönliche längst hinaus. Es wird aufs Neue etwas Geschlechtsspezifisches! Es sind damit Aufgaben formuliert, die in die Zukunft weisen. Und es muss nicht gleich und immer gelingen, aber wunderbar, wenn es das tut.
J. Wisch: Mir wird deutlich, dass diese Art der Trauung etwas ist für „Eingeweihte“, also für Menschen, die einen spirituellen Weg im Sinne der Anthroposophie schon ein ganzes Stück weit gegangen sind. Für diese ist das klar nachvollziehbar. Das ist ein deutlicher Unterschied zu unserer Situation.
Was mich persönlich sehr berührt hat, ist dieser Aspekt, wie Sie es formulieren: „ins Licht des auferstanden Christus rücken“, weil das – so sehe ich das – bei der Trauung eine große Rolle spielt. Die Trauung, oder „der Gottesdienst anlässlich einer Trauung“, ist weit mehr als das Besiegeln einer gelingenden Beziehung. Es geht nicht nur um die positiven Aspekte des Segens, sondern es geht auch um das Bestehen in Bedrohungen der Beziehung, also religionspsychologisch ausgedrückt, in der Situation des Fluchs. Es gehört ja zu den fast unausweichlichen Erfahrungen einer Partnerschaft, auch schuldig aneinander zu werden, zu verletzen. Die Ambivalenzen des Lebens sind in keiner unserer Kasualien so erkennbar und thematisch so wichtig wie bei der Trauung. Auch deshalb finde ich es wichtig, den Bezug zu Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, herzustellen, um die Ambivalenzen, die im Geschehen einer lebenslangen Beziehung stecken, zu thematisieren. Wenn ich mich entschließe zu heiraten, mit jemandem lebenslang in Beziehung zu leben, so geschehen zugleich Trennungen, z.B. in der Bindung an Vater und Mutter. Es gibt Träume und Hoffnungen mit dieser Ehe, aber auch Ängste und Ahnungen von den Grenzen, die die Beziehung setzt. Diese Ambivalenz versuche ich in jedem Traugespräch und auch im Ritual der Trauung im Blick zu haben. Aber ich muss in der Gestaltung und in der Ansprache mit im Blick haben, dass viele der Menschen, die dabei sind, vielleicht vor zehn oder zwanzig Jahren das letzte Mal in der Kirche waren, dass also Glaubensthemen für sie nicht ohne weiteres verständlich sind. Mit dem Brautpaar kann ich manches im Gespräch klären. Aber für die Trauung ist dieser oft deutliche Traditionsabbruch ein Problem.
gleichgeschlechtliche Ehe
C. P.: Herr Fischer, das Trausakrament in der Christengemeinschaft ist dann eine Angelegenheit für eine Frau und einen Mann? Für eine gleichgeschlechtliche Ehe würde das also gar nicht passen?
E. Fischer: Nein, es würde nicht passen. Trotzdem kann ein gleichgeschlechtliches Paar einen Segen erhalten und da wäre ich in einer anderen Weise behilflich. Da ist gar nichts dagegen zu sagen.
C. P.: Herr Wisch, würden Sie gleichgeschlechtliche Paare in einer Amtshandlung trauen?
J. Wisch: Ich würde das nicht „trauen“, sondern segnen nennen. Da bin ich dann theologisch gesehen mit dem „Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung“ nahe dran, im Sinne von gegenseitigem Partnerschaftsversprechen, oder wie immer man das nennen will. Es ist die Parallelität gegeben: es ist ein öffentlich-rechtliches Verhältnis, das eingegangen wird; dazu kann dann dieser Gottesdienst treten. Darin sehe ich kein Problem. Aber es wird ein Unterschied im Ritus geben, denn die Selbstverständlichkeit, mit der im Ritus der Trauung als Grundlage für ein Bild von Ehe eines verschiedengeschlechtlichen Paares ein Bezug zur Schöpfungsgeschichte hergestellt wird – „und er schuf ihn als Mann und als Frau“ – taugt dann nicht.
Auch bei der Trauung von gemischtgeschlechtlichen Paaren habe ich immer ein wenig „theologisches Bauchweh“, wenn ich mich so selbstverständlich auf die Schöpfungsgeschichte beziehe, weil ich diesen anderen Fall der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft im Blick habe: Partnerschaft ist mehr als Beziehung zwischen Mann und Frau. Die lebenslange Partnerschaft in einem spirituellen Sinne ist auch zwischen homosexuellen Partnern möglich. Ich kann die Schöpfungsgeschichte theologisch deuten und sagen, dass an dieser Stelle zum Ausdruck kommen soll: sowohl Gott als auch der Mensch ist auf Beziehung angelegt. Das ist es, was „Gottesebenbildlichkeit“ hier ausdrückt. In unserem trinitarischen Gottesbild bringen wir zum Ausdruck, dass Gott selbst in sich Beziehung ist. Gott geschieht sozusagen in der Beziehung von Schöpfer, Jesus Christus und Heiligem Geist. Und auf den Menschen bezogen ist in beiden Schöpfungsgeschichten der Kern nicht eigentlich das Geschlechtliche, sondern dass der Mensch auf Beziehung angelegt ist; in der zweiten Schöpfungsgeschichte, viel archaischer erzählt, läuft Adam alleine im Paradies herum und Gott merkt, wie er daran leidet und will ihm ein Gegenüber schaffen. Dass er die Frau dann aus einer Rippe schafft, was dann oft wie ein minderer Teil ausgelegt wird, ist ein Mangel, den Bilder oft haben. Aber es geht vor allem um das Gegenüber und darum, in Beziehung zu treten, also, wie es heißt: Das ist jetzt Fleisch von meinem Fleisch, also: Wir sind aus gleichem Stoff gemacht, wir können zueinander in Beziehung treten, einander verstehen.
C. P.: Wenn man eine Ehe scheidet, vor allem eine mit Trausakrament vollzogene, was passiert da geistig?
E. Fischer: Man muss akzeptieren, dass die Gemeinsamkeit des Lebens nicht gelungen ist. Es gibt dabei viele Zwischenstufen, beispielsweise verstehen sich manche weiterhin als Paar, aber in getrennten Wohnungen. Bei anderen ist es auch mit einem gewissen Abstand nicht zu leben. Aber was da einmal ergriffen und bejaht worden ist, bleibt in der Biografie drin. Man wird in der Regel mit dem verlassenen Partner irgendwie wieder zu tun bekommen.
Oft entsteht mit einem anderen Partner wieder eine neue Beziehung, und manchmal möchte man das Sakrament dann wieder haben. Das ist eine sehr sensible Sache, weil man an Wunden oder Narben rührt. Man braucht dafür viel Vorbereitung, weil schon eine Beziehung da war, die man dann selbstverständlich einbezieht, weil sie zum Leben gehört und insofern auch nicht lösbar ist – ohne das moralisch zu beurteilen. Wenn ein neuer Partner zu diesem Menschen ja sagen würde, macht er das damit auch zu dessen Vergangenheit. Wenn der neue Partner das schafft, kann man auch eine Trauung wiederholen.
C. P.: Es ist auch ein psychologisches Phänomen, das man von Familienaufstellungen kennt: wenn ein zweiter Partner oder zweite Partnerin da ist, muss er/sie akzeptieren, dass es einen ersten oder eine erste gab. Wenn dann der zweite die Rolle des ersten einnehmen will, reibt sich das, bzw. es funktioniert nicht.
E. Fischer: Es hat sicher keinen Sinn, diese erste Beziehung einfach zu ignorieren und unter den Teppich zu kehren. Alles, was man unter den Teppich kehrt, kommt später wieder hervor.
J. Wisch: Das sehe ich ganz genau so, nur hängt es natürlich nicht an der Eheschließung. Ich kenne aus dem persönlichen Umkreis jemanden der viele Jahre mit einer Frau zusammengelebt hat, ohne verheiratet zu sein. Und dann hat er, nach der Trennung, schließlich eine andere Frau geheiratet. Da geht es ganz genau so, dass die zweite Partnerin eben die zweite ist und sie akzeptiert, dass eine erste da war. Die Geschichten, die Prägungen dieser ersten langjährigen Beziehungen sind auch in der zweiten Partnerschaft gegenwärtig, auch wenn die erste formell keine Ehe war. Das hängt nicht an dem Ritual der Eheschließung und auch nicht an dem spirituellen Entschluss dazu.
Und andererseits ist genau das, was Sie beide beschrieben haben, ein Anlass daran zu arbeiten, ein gutes Ritual zu finden, um die Scheidung zu vollziehen. Gerade bei dem Umgang mit Verletzung, Schuld und Scheitern sind nach meiner seelsorgerlichen Erfahrung nicht nur Gespräche, sondern auch Rituale besonders hilfreich, das zu bewältigen ohne es verdrängen zu müssen.
ein Scheidungs-Ritual
C. P.: Wie kann man sich solch ein Scheidungsritual vorstellen?
J. Wisch: Wenn, was heute immer häufiger möglich ist, eine Scheidung so verläuft, dass die beiden noch miteinander reden können und eine Nähe bleibt, fände ich es eine Idealvorstellung, dass man gemeinsam mit Freunden einen Gottesdienst feiert, in dem man in einem ersten Teil noch einmal in Dank und Klage Rückschau hält: was hat unsere Beziehung ausgemacht, was ist gelungen, was ist nicht gelungen. Als nächstes sollte man ein Ritual finden für die Trennung, beispielsweise die Ringe ablegen, oder für den gelungenen und gescheiterten Teil jeweils Dinge, gemeinsam als passend überlegte Symbole, ablegen. In einem dritten Teil würde man einander frei geben, unter Umständen sogar, gerade wenn Kinder dabei sind, einander ein neues Versprechen ablegen. Wie Sie auch gesagt haben: die Beziehung bleibt oder man begegnet sich wieder und wenn es eine gelingende Trennung sein soll, müsste man sich darüber klar werden, wie die gemeinsame Beziehung in Trennung danach aussehen soll. Das könnte alles Gegenstand eines neuen Versprechens sein. Und dann würde ein Segen für die getrennten Wege den Ritus abschließen
„anständiges Begräbnis“
E. Fischer: Da kann ich gut mitgehen. Ich würde keinen Impuls haben, das zu ritualisieren. Ich nenne so etwas immer „anständiges Begräbnis“. Dass man aber das, was nicht gelungen ist, mit gemeinsamen Bewusstsein anschaut, ohne Häme und inneren Wallungen. Das ist bei allen sozialen Angelegenheiten eine günstige Sache, wenn beispielsweise jemand eine Initiative für einen Verein, vielleicht eine Waldorfschule, einen Bauernhof hatte, und das dann misslingt. Es ist gut, wenn man sich dann noch einmal trifft und das gemeinsam wahrnimmt.
Das ist es auch, was im persönlichen Bereich das Beichtsakrament ausmacht: das darauf Schauen und bei Lichte betrachten und sich sagen, dass es so ist, wie es ist – um es frei zu bekommen von den begleitenden Stimmungen, die wir immer haben. Das Urbild dafür ist Johannes 8, die Ehebrecherin: da werden die ganzen Pharisäer weggeschickt und es wird nur angeschaut, was auf die Erde geschrieben ist. Man akzeptiert: das ist meines oder auch unseres, denn zum Scheitern gehören immer zwei mindestens; nie ist nur einer daran schuld. Da könnte man noch viel Kulturarbeit entwickeln.
Nur: ein Ritual dafür würde ich nicht suchen.
C. P.: Sie haben beide bereits zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten angedeutet. Gibt es dem noch etwas hinzuzufügen?
E. Fischer: In diesem spirituellen Kultivieren von Frau und Mann steckt noch unendliches Potential. Die Emanzipation ist im Wesentlichen geleistet – jedenfalls in unserem Kulturbereich. Seelisch ist das schon präsent, und wir dürfen auch Mann sein und dürfen auch Frau sein. Ich hoffe darauf, dass diesbezüglich in der spirituellen Dimension sich einiges entwickelt. Die Zeichen deuten darauf hin, weil die individuelle Einsamkeit so hart erlebt wird. Ein Seelentrost genügt dafür nicht. Meine baltische Tante hat Seelennot immer mit Essen heilen wollen: „Junge, iss ma watt!“ Das hat überhaupt nichts genützt. Wer aus seiner innersten Einsamkeit, aus dem Ich heraus die Partnerschaft sucht, muss um Gottes Hilfe nicht mehr lange bitten. Das Sakrament geschieht.
J. Wisch: Wir haben erst vor kurzem den Einführungsgottesdienst für meine neue Pfarrstelle gefeiert und da war der Predigttext 1. Kön 19, „Elia in der Wüste“. Elia ist sozusagen lebensmüde, legt sich nieder und will nicht mehr. Da kommt ein Engel, gibt ihm Brot und Wasser und sagt: „Steh auf und iss“. Das passiert zweimal, das erste Mal steht er wieder auf, isst und legt sich wieder hin zum schlafen. Dann kommt der Engel zum zweiten Mal und sagt: „Steh auf und iss, denn du hast noch einen weiten Weg vor dir.“ Dann geht Elia 40 Tage und 40 Nächte kraft dieser Speise zum Berg Gottes. Dort erscheint ihm Gott ganz anders, als er es immer gekannt hat: eben nicht machtvoll, erschütternd und eindimensional als der große, allmächtige, sondern – wie Luther es sagt – als „still sanftes Sausen“. Der Alttestamentler J. Ebach, übersetzt es als „magerer Windhauch“. Gott ist ganz anders und so, wie ihn Elia jetzt braucht, wie er ihn jetzt erreichen kann in seiner Stimmung von Resignation und Depression. Dadurch kann er ihm nahe kommen. Das braucht aber einen Weg von 40 Tagen und 40 Nächten und dazu braucht er Brot und Wasser.
Mein Bild von Kasualien im Sinne meiner Stelle ist: wie weit gelingt uns das, für Menschen eine solche Station zu sein, wo ihnen Brot und Wasser gereicht wird in einem spirituellen Sinne? Eine Speise, die ihnen Kraft gibt sich auf den Weg zu machen, Gott zu entdecken und einen für sie stimmigen Bezug zu Gott zu finden. Für mich ist das auch ein schönes Bild dafür, dass wir bei den Kasualien mit Menschen zu tun haben, die nach 10 bis 20 Jahren das erste Mal wieder in Kontakt kommen mit dieser Dimension, und wir sie oftmals „abspeisen“ – sage ich einmal etwas böse. „Wir machen euch einen schönen Ritus, denn mehr wollt ihr ja auch gar nicht“. Das ist eine Überheblichkeit, die wir als Pastoren – dabei schließe ich mich selbst mit ein – oft haben. Wir lassen uns nicht in aller Ernsthaftigkeit darauf ein, mit zwei oder drei Traugesprächen dem auf die Spur zu kommen, was die spirituelle Dimension dieser Beziehung ist oder was die Art ist, wie Gott für dieses Paar eine Rolle spielt – keine Moralpredigt, keine psychotherapeutische Sitzung, sondern ihnen „Wasser und Brot“ geben; diese Menschen willkommen heißen, sie so nehmen wie sie sind. Und dann „schläft er erst noch mal wieder ein“, d. h. es gibt einen zweiten Anlauf und eine zweite Begegnung, noch einmal Wasser und Brot, und Elia geht aus dieser Begegnung als ein anderer hervor.
Das ist mein Wunschtraum, dass wir als Kirche dafür neu den Blick öffnen. Die Sehnsucht der Menschen danach ist da und auch die Notwendigkeit, dafür etwas erst mal freizulegen und dem auf die Spur zu kommen.