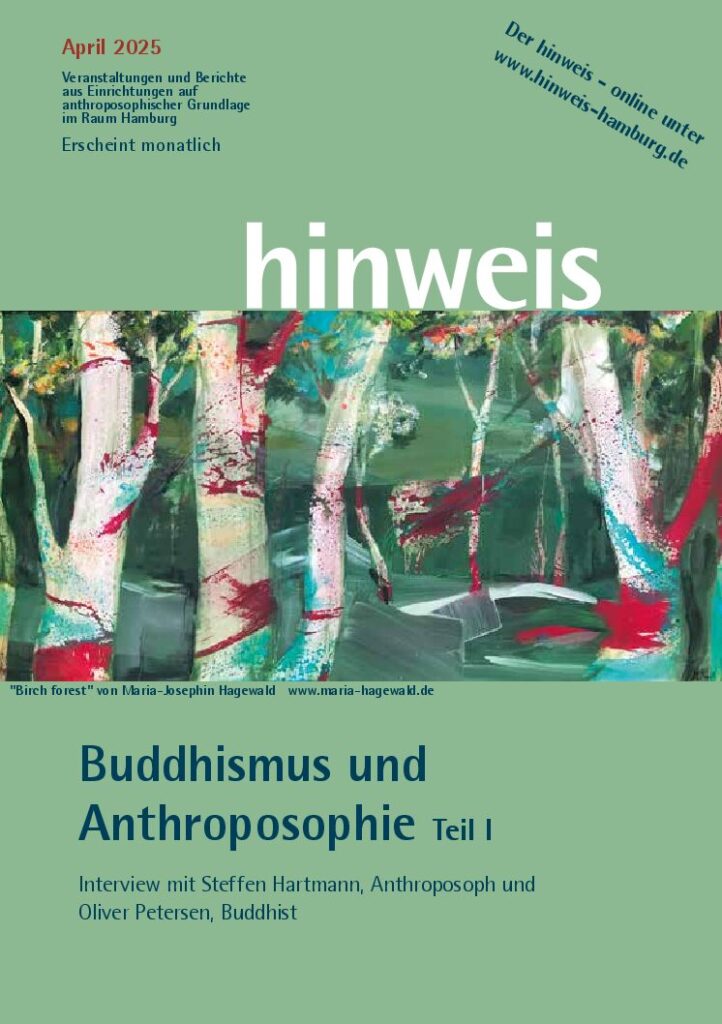Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
Die Suche nach dem eigenen Ich, Teil I und II
Selbstportraits in der Kunstgeschichte
Zusammenfassung eines Vortrages von Martin Straube, Arzt
Zu einem besseren Verständnis dieses Vortrages dienen die Gemälde, wie sie in der pdf-Ausgabe im Archiv zu sehen sind.

Es ist nicht leicht, sich selber in den Blick zu nehmen. Der Weg der Selbstreflexion steht in dem Spannungsfeld von zu viel Selbstkritik einerseits oder Selbstverliebtheit anderseits. Manches, was wir über uns ahnen, ist schwer in Worte zu kleiden, aber es ist leichter in Bildern zum Ausdruck zu bringen. So sind die Selbstbildnisse in der Kunst Reflexionen über das Bild, das der Künstler von sich selber hat.
Zu diesem Thema hielt der Arzt Martin Straube am 5. September 2011 im neu gegründeten Institut Diogenes einen Vortrag.
Martin Straube, Arzt; geb. 1955 in Bremen; Studium der Medizin in Freiburg und Kiel. Anstellungen in der Filderklinik, Städtisches Krankenhaus Pforzheim und Klinik Öschelbronn. Danach Praxistätigkeit in einer AIDS-Schwerpunktpraxis in Pforzheim im Rahmen der „Amfortas-Gemeinschaft“. Später Schularzt in Herne im Rahmen des „Kolisko-Institutes“. In Wuppertal im Rahmen der Akademie für Sozialtherapie und dem Ita-Wegman-Berufskollegs für Heilerziehungspflege eine Dozenten- und Lehrerstelle. Zudem Schularzt in Remscheid und Dozent im Institut für heilpädagogische Lehrerbildung in Witten. 2002 Praxis in Bochum und Schularzt in Bochum. Laufende Vortragstätigkeit an Schulen und im Rahmen der medizinischen Fortbildung. Seit Herbst 2010 wohnhaft in Fischerhude, mit einer kleinen Praxis. Verheiratet, 7 Kinder.
Sich selber in den Blick zu nehmen und diesen Blick für Wert zu halten, ihn der Mit- und Nachwelt verfügbar zu machen, ist keine alte Tradition. Sie begann eigentlich erst mit der Renaissance. Es gibt nur wenige Vorläufer. Phidias (* um 500 v. Chr. in Athen; † um 432 v. Chr. in Athen), der große griechische Bildhauer hatte sein Konterfei auf dem Schild der Göttin Athene abgebildet. Das war ein Skandal. Er wurde verhaftet und starb bald danach an einer Vergiftung. Genaue geschichtliche Umstände sind nicht klar. Ob er wegen des Selbstbildnisses starb, ist unsicher. Aber man tat dergleichen nicht, schon gar nicht auf einem Götterbildnis. Denn der Künstler war Handwerker und nur sein Werk zählte, er war ein Diener, der eine Sache, Personen oder Götter darzustellen hatte und nicht sich selbst. Zum Anderen war der Blick auf sich selbst etwas gefährliches.
In Ägypten stand das Abbild der Göttin Neth in Sais, wo viele vornehme Griechen sich ausbilden ließen. Die Inschrift an dem dazugehörigen Tempel lautete:
„Ich bin alles, was ist, war und sein wird, meinen Schleier hat kein Sterblicher aufgehoben.“
Dies blieb ein Rätsel bis in die Neuzeit. Schiller widmete dem eine Ballade, in der ein ungestümer Jüngling den Schleier heimlich hob, was nie zuvor geschah, da darunter „die Wahrheit“ zu sehen sei. Die Ballade endet mit den Worten:
Er spricht’s und hat den Schleier aufgedeckt.
»Nun« fragt ihr, »und was zeigte sich ihm hier?«
Ich weiß es nicht. Besinnungslos und bleich,
So fanden ihn am andern Tag die Priester
Am Fußgestell der Isis ausgestreckt.
Was er allda gesehen und erfahren,
Hat seine Zunge nie bekannt. Auf ewig
War seines Lebens Heiterkeit dahin,
Ihn riss ein tiefer Gram zum frühen Grabe.
»Weh Dem« dies war sein warnungsvolles Wort,
Wenn ungestüme Frager in ihn drangen,
»Weh Dem, der zu der Wahrheit geht durch Schuld:
»Sie wird ihm nimmermehr erfreulich sein.«
Novalis gibt ihm eine andere Wendung in seinem bekannten Zweizeiler:
Einem gelang es – er hob den Schleier der Göttin zu Sais –
Aber was sah er? – Wunder des Wunders – Sich Selbst.
So wenig historisch die späteren Dichtungen sind, sie drücken viel von dem Verständnis aus, das seinerzeit mit dem Selbstbildnis verbunden war: eine tödliche Gefahr.
Auch hatte man die Vorstellung, die in vielen Totenbüchern Niederschlag fand, dass man sich im Moment des Todes als sein wahres Bild sehen würde.
Andererseits gibt es das Motiv der Selbstliebe, das in der griechischen Sagenwelt sich mit dem Schauen des eigenen Bildes verknüpfte. Neben dem Tod, der von dem Gott Tanatos beherrscht wurde, stand die Libido als Polarität: Tod als Entäußerung des Selbst und die Libido als Gefangenheit in sich.
Die griechische Sage erzählt von einem Jüngling, der sein eigenes Bild in einem See gespiegelt sieht und sich in das Bild verliebt, da er es nicht fassen kann, denn es ist ein gegenstandsloses Bild auf dem Wasser, kann er sich nicht abwenden: Narziss, der Wurzel schlägt und ewig in das Wasser schaut, wie die Narzisse, die Osterglocke, die an Ufern blühend, ihre Blüte nach unten öffnet, als wolle sie ihr Bild im Wasser betrachten.
Dies macht zum einen die Flüchtigkeit des Bildes deutlich und dass es das Wasser ist, das mit der Natur des Bildes aufs engste verbunden ist. Es belebt, wenn wir es verinnerlichen, es lässt uns ertrinken, wenn wir zu stark und zu lang eintauchen. Es spendet Leben, bringt aber auch Tod. Bilder entstehen dazwischen.
„Erkenne Dich selbst!“ stand über Jahrhunderte im Apollotempel in Delphi geschrieben. Es war eine Aufforderung an den Adepten, der eine Einweihung in die Mysterien der Wahrheit begehrte. Es war ein Weg, der in den Tempeln von Göttern und eingeweihten Lehrern begleitet und geschützt wurde. Die damit verbundene Selbstbewusstheit war etwas Besonderes und nur Eingeweihten oder gottgleichen Fürsten vorbehalten. Sonst war er von zwei Gefahren begleitet: vom Tod und der Selbstverliebtheit.
Das Selbstbildnis als Methode der Reflexion
Die Reflexion ist der Königsweg allen Lernens. Lernen ist immer ein Vorgang zwischen dem Lernenden und dem Lern-„stoff“. Das Ergebnis wird immer auch durch den Lernenden geprägt. Nur wenn ich diesen eigenen Anteil im Bewusstsein habe, kann ich einen Lernvorgang steuern. Das nennen wir Reflexion.
Es ist aber nicht leicht, sich selber in den Blick zu nehmen. Der Gegenstand – der Reflektierende selbst – ist unscharf, wenig abstrakt, hat viele undeutliche emotionale und unbewusste Anteile, die sich dem analytischen Blick entziehen wollen. Beim Lernen ein Stück Welt zu betrachten, ist wesentlich einfacher. Manches, was wir ahnen, ist schwer in Worte zu kleiden, aber es ist leichter zu beantworten, ob es dunkel oder hell, matt oder glänzend, warm oder kalt ist – solche Sinnesassoziationen zu unseren Gefühlen, Ahnungen, tiefen Motiven und Begehren, zu unseren Abgründen, Verruchtheiten und Sorgen können in Bildern zum Ausdruck kommen, oft noch bevor es dem Betreffenden selber bewusst wird oder bevor er es formulieren kann.
Selbstbildnisse in der Kunst sind Reflexionen über das Bild, das man von sich selber hat. Anders als ein Schnappschuss mit einer Digitalkamera. Ein Selbstbildnis war oft eine wochenlange Arbeit. Wir dürfen davon ausgehen, dass ein Künstler sich intensiv gefragt hat, ob ein Bild dunkel oder hell, bunt-farbig, gering farbig differenziert oder gar Grau in Grau gemalt ist. Ist es hochkant oder querformatig, ist nur das Gesicht oder ein Brustbild gemalt, ist die ganze Gestalt abgebildet, bei welcher Tätigkeit, ohne oder mit Kleidern, mit welchen Attributen, mit welcher Mine, welchem Blick ist der Künstler dargestellt? Ist er alleine oder umgeben von anderen Menschen und welchen? Alles das drückt etwas aus darüber wie er sich sieht: Stellt er sein Licht in den Schatten, ist er von sich überzeugt, ist es ein Selbstzweifler usw.?
sich selbst fragen, in welchen Selbstportraits wir uns wieder finden
Es kann interessant sein, sich so Künstlerpersönlichkeiten zu nähern, aber auch, wenn wir viele Selbstporträts so ansehen, sich zu fragen, in welchen wir uns vielleicht wieder finden. Dann ist es egal, ob wir den Künstler „richtig“ verstanden haben oder falsch. Wichtiger ist dann, ob wir das, was wir in seinem Bild sehen, bei uns wieder finden. Dann wird das Betrachten von Selbstbildnissen selbst ein reflektiver Prozess für den Betrachter und ist daher immer lohnend.
Reflexion ist immer subjektiv.
Das nebenstehende Bild Picassos (Maler und Modell) legt nahe, dass der Betrachter (Maler) und die Betrachtete (Modell) nicht in ihrer vollmenschlichen Persönlichkeit sich gegenübertreten, sondern als Rollen- oder Funktionsträger: Beide tragen Masken. Ihre volle Persönlichkeit mit allen Idealen, Gefühlen, Motiven, Glaubenssätzen bleibt außen vor. Der Blick des Malers ist professionell deformiert. Er malt das Modell. Aber was sehen wir auf der Leinwand? Ihn! Bei aller Professionalität sehen wir die Welt durch unsere eigenen Bilder hindurch. Und die haben mehr mit uns, als mit der Welt zu tun. Insofern sind alle Bilder immer auch Selbstbildnisse. Das Selbstbildnis selber geht damit am bewusstesten um: Welches Bild habe ich von mir selber? Sehe ich all meine Schwächen, mein Versagen und stelle mich als kleiner dar, als ich bin, oder stelle ich mich, mit der Tendenz der Selbstliebe und mit Selbstüberschätzung, als größer dar, als ich bin?
Zwei Beispiele dazu:
Die große Zeit des Porträts und damit auch des Selbstporträts ist die Renaissance. Erst hier war es ein Bedürfnis, auch sich selber zur Darstellung zu bringen und sich nicht in den Hintergrund zu stellen.
Im Zentrum dieser Entwicklung stand Italien und dort Florenz. Das kleine Florenz empfand sich immer in Konkurrenz zum großen Venedig. In der Entwicklung der Künste überflügelten die florentiner Künstler die venezianischen. Das führte zu einer hohen Identifizierung der Florentiner mit ihrem Schutzpatron David, der den großen Goliath besiegt hatte.
Giorgione malt sich 1510 als David. David war nicht nur der Hirtenjunge, der Goliath besiegte, David war auch später König, und er war Künstler: Mit seiner Musik heilte er die Depression Sauls, als Dichter kennen wir ihn als Autor der vielen Psalmen. In welcher Rolle stellt sich Giorgione dar? Der Hirtenjunge trug keine Rüstung, der König war stolzer. Der melancholische Blick aber galt als der Blick des Dichters, des Künstlers! Als Giorgiones Spezialität galt der Glanz. Ihm gelang es wie keinem Anderen, Lichtreflexe auf spiegelnden Oberflächen zu malen. Das zeigt er auf dem kleinen Stückchen der Rüstung auf seiner Schulter. (siehe Seite 10)
Dieses Selbstporträt will sagen: „Seht her, ich bin ein Florentiner Künstler, ich erhöhe durch meine Kunst die Ehre der Stadt Florenz, gemäß der Würde, die ihr durch den Schutzpatron David zukommt. Indem ich den Glanz male, erhöhe ich den Glanz dieser Stadt!“ – nur war Giorgione kein Florentiner; er war Venezianer! Hier nimmt er für sich in Anspruch auch zu können, was die Florentiner auszeichnete – vielleicht ist darum sein Blick auch etwas verächtlich und überheblich geraten?
Was aber Caravaggio veranlasst hat, sich nicht als David, sondern als Goliath zu verewigen, wissen wir nicht. (Siehe Seite 10) Wir wissen auch nicht, wer hier in der Gestalt des David abgebildet ist. Caravaggios Antlitz erscheint hier in den Zügen des frisch enthaupteten Goliath, gehalten von der linken Hand Davids, dessen Rechte noch das Schwert gezückt hält. Eigentümlicherweise scheint David weder stolz, noch siegesfreudig zu sein. Er schaut fast liebevoll, zugewandt und mitfühlend mit seinem geneigten Kopf, als wolle er sich entschuldigen. Davids Tat erscheint hier nicht als glänzender Sieg. So ist Goliaths Tod auch keine Niederlage.
Ist der David vielleicht sogar der junge Caravaggio, der den alten überwunden hat? Ist der Alte der Gewordene und der Junge der Werdende? Ist dies ein Entwicklungsbild? Ist der „neue“ Caravaggio vielleicht mehr ein Tat-Mensch, der den alten Kopf-Mensch überwunden hat, im Sinne vom Ablegen eines Zustandes und Geburt eines neuen, dessen Zukunft ebenso unverbraucht ist (jung), wie die Vergangenheit des Anderen verbraucht („alt“)?
Caravaggio, der bereits mit 36 Jahren starb, war berüchtigt. Nicht nur seine Malerei war erschreckend „realistisch“ (z.B. auf dem Gemälde „die Rosenkranzmadonna“ sieht man die dreckigen Füße der Knienden, was zu großem Entsetzen Anlass gab), viele Gemälde sind gruselig, nein auch sein Lebenswandel schockierte: Er war pädophil, bisexuell, trinkfest, rauflustig und kriminell. Nachdem er einen Duellgegner getötet hatte, floh er, nach einer Beleidigung eines Ritters kam er ins Gefängnis, dem er aber entfliehen konnte. Das alles entsprach Eigenschaften, die man Goliath auch nachsagte. Das Wort „Riese“ hatte lange Zeit die Bedeutung des Monsters, des kulturlosen Naturungeheuers. Und: Caravaggio war nie in Florenz! Ein perfekter Goliath…
Rembrandt, der Maler mit den meisten Selbstbildnissen
Wie sich dieser Blick wandeln kann, zeigt Rembrandt, der Maler mit den meisten Selbstbildnissen (ca. 80). Auf Seite 12 drei Bilder aus den Jahren 1629, 1640 und 1669. Im Jugendbild lebt die ganze Neugier und Lust auf die Welt, die er überrascht und mit leicht geöffnetem Mund staunend betrachtet, während die Augen auf diese Welt gerichtet sind und sich selber nicht wahrnehmen. Im Altersbild, kurz vor dem Tod entstanden, ist der Blick mehr versonnen nach innen gerichtet, die vor dem Bauch gefalteten Hände zeigen eine innere Ruhe an, die Welt dringt wenig an ihn heran, wird ihn wohl schwer aus der Ruhe bringen. Vermutlich nimmt er weniger die Welt, als sein reiches Innere wahr. Im mittleren Bild ist er ein reifer, erwachsener Mann im mittleren Alter, ebenso wach für die Welt, wie selbstsicher und von sich überzeugt. Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass der Ausschnitt der Bilder sich verschiebt, das Jugendbildnis fast nur den Kopf, das Erwachsenenbild auch die Herzregion und das Altersbild zusätzlich den Bauchraum zeigt, als würde er immer „kompletter“, als käme zu der Sinneswachheit des Jugendlichen das Herz im Erwachsenenalter hinzu und im Alter auch der Bauch, Sitz des Stoffwechsels und des Willens. Die Veränderungen des Blickes über die drei Stufen der Jugend, des Erwachsenen und des alten Menschen sind urbildhaft für biographische Wandlungen. Die Frage, die sich aus dieser Entwicklung ergibt, ist, ob es in der Biographie eine ähnliche Situation gibt, wie in der Bewusstseinsgeschichte der Menschheit, von der ab erst ein freier reflektiver Blick in der Natur des Menschen liegt. Die Motivationspsychologie beschreibt aus der reflektierenden und evaluierenden begleitenden Beobachtung von Personalgesprächen und der Gründe für Ablehnung und Zustimmung zu einer Einstellung fünf intuitive Faktoren der Menschenbeurteilung, die so genannten „big fife“. Das sind
1. die Extrovertiertheit (Ist die andere Person oder man selbst lebhaft, überzeugend, optimistisch und gesellig?)
2. die Neugier (Ist die andere Person oder man selbst flexibel, fantasievoll und interessiert?)
3. die emotionale Stabilität (Ist die andere Person oder man selbst ausgeglichen, robust und stressresistent?)
4. die Verträglichkeit (Ist die andere Person oder man selbst freundlich und hält sich an soziale Normen?) und
5. die Gewissenhaftigkeit (Ist die andere Person oder man selbst verlässlich, ordentlich und fleißig?)
Diese Charaktereigenschaften werden als Persönlichkeitsmerkmale verstanden, die zwar individuell unterschiedlich gemischt sind, aber im Querschnitt überindividuell einem Muster folgen, das in der Jugend Neugier und Extrovertiertheit ebenso überwiegen, wie im Alter die Verträglichkeit und die Zuverlässigkeit. Die emotionale Stabilität gewinnt als Ausdruck der Reife eine erkennbare Deutlichkeit im mittleren Erwachsenenalter.
Verdeckt die Realität vielleicht das, was aus den Bildern sprechen kann?
Im Jahre 1646 malt der 23 Jahre junge österreichische Maler Johannes Gumpp das nebenstehende Selbstbildnis, das ihn als einen großen Künstler ausweist. Bald danach stirbt er, und weitere Bilder von ihm sind nicht bekannt geworden.
Auf dem Bild ist er dreifach zu sehen. Wir sehen ihn von hinten, raumfüllend und dunkel in der Mitte mit Pinsel und Malstab. Links davon sehen wir sein Abbild im Spiegel und rechts das kreative, gemalte Bild auf der Staffelei. Sehen wir den „realen“ Gumpp nur von hinten, dunkel und sich vor uns, dem Betrachter verbergend, so sind das Spiegelbild und das gemalte Bild heller und uns stärker zugewandt. Beim genaueren Betrachten aber unterscheiden sich Spiegelbild und gemaltes Bild ebenfalls: Das Spiegelbild ist blasser, in stumpferen Farben gemalt, ohne Glanz in den Augen und schmaler. Das kreative Bild ist fülliger, heller und durch den Glanz in den Augen lebendiger.
Verdeckt die Realität vielleicht das, was aus den Bildern sprechen kann? Immerhin nimmt der „reale“ Gumpp den größten Teil der Fläche ein und verdeckt die beiden anderen zum Teil. Und sehen können wir am realen Gumpp kaum etwas. Außer dem hellen Kragen ist er nur dunkel und – wäre die Beziehung von Realität, Abbild und kreativen Bild nicht so spannend – stört. Aber er steht in der Mitte.
Das kreative Bild wirkt, ist offen, nimmt Kontakt mit uns auf, tritt in Beziehung
Das noch genauere Hinsehen irritiert noch mehr. Der „reale“ Gumpp scheint, der Drehung seines Kopfes nach zu urteilen, in den Spiegel zu blicken. Aber das Abbild im Spiegel schaut nicht zurück, sondern sein Blick weist auf die Staffelei. Der gemalte Gumpp auf der Staffelei blickt den Betrachter außerhalb des Bildes an. Aber die Blicke sind unterschiedlich, nicht nur, was die Richtung angeht, die sich spiralig von innen nach außen dreht, sondern auch der Ausdruck des Blickes ist anders. Der Gumpp im Spiegel hat einen dunkleren Blick, als der gemalte. Und im Gesicht auf dem Spiegel liegt Enttäuschung und eine gewisse Introversion. Der gemalte Gumpp scheint uns mit einem gewissen Stolz anzusehen. Er hat eine Ausstrahlung, die das tote Abbild im Spiegel nicht hat. Wäre es ein Wettbewerb, den hier die Realität, das Abbild und das kreative Bild veranstalteten, das gemalte Bild wäre der Sieger. Es hat Ausstrahlung, Selbstsicherheit, Stolz und Lebendigkeit. Das Abbild im Spiegel ist lebloser, ihm fehlt die Strahlkraft. Es gibt im Spiegel die Realität wieder, fügt ihr nichts hinzu, aber es fehlen ihm der Glanz und das Leben. Die Realität verbirgt sich uns, verstellt sogar den Blick auf das Eigentliche, nimmt aber eine zentrale Stelle und den meisten Raum ein, aber verdunkelt alles.
Das kreative Bild wirkt, ist offen, nimmt Kontakt mit uns auf, tritt in Beziehung, strahlt aus und ist lebendig. Auf der Staffelei, ihr zugeordnet liegen Lebensmittel. Ein Kuchen und eine Frucht. Das erhöht noch einmal die Lebendigkeit, die nährend ist. Gumpp will hier vermutlich sagen, dass es das Einzige ist, auf das es ankommt. Das Bild wirkt. Es ist eine Wirklichkeit. Die Realität ist zwar realer, aber die Wirklichkeit kommt dem Leben näher und übersteigt die Realität.
Im Vordergrund sehen wir von rechts einen zähnefletschenden Hund in das Bild ragen und links zwei Katzen, die dem Hund entgegenblicken. Mit dem geschilderten Wettkampf von Realität und Wirklichkeit haben sie nichts zu tun. Es ist eine menschliche Auseinandersetzung…
Dieses Selbstbild ist es, das uns treibt, das unsere Potentiale und Motive zeigt.
Selbstbildnisse von Studierenden
Um die Gefahren der Reflexion zu vermeiden (die abbauende scharfe Fixierung auf Fehler, Versagen und Unvermögen, die das Selbstbild schwächt oder zerstört und damit dem Todesprozess verwandt ist und die Selbstverliebtheit, die unkritisch sich an dem aufbaut, was in Selbstüberschätzung als sehr positiv wahrgenommen wird und damit dem Bild des Narzissmus entspricht), ist sicher das Jugendalter überfordert.
In einer Fachschule für Heilerziehungspfleger, in der ich unterrichtete, hatten wir im Wesentlichen jüngere Studierende, die sich zum größten Teil im Alter von Anfang Zwanzig befinden.
in dem, was nichts ist, entdeckte er sein „Ich“
Ein Studierender zeigte uns sein großformatiges Selbstbildnis, das auf schwarzem Grund in Lebensgröße fragmentarische Gipsabdrücke seines Körpers zeigt.(Seite 14) Er leitete seine Präsentation damit ein, dass er sagte, er sei kein religiöser Mensch und glaube nicht an einen Gott. Ursprünglich wollte er einen gesamten Abdruck von sich schaffen, weil er eben so sei, wie er sei, nicht mehr und nicht weniger. Im Tun waren es nicht nur technische Schwierigkeiten, die das Vorhaben einschränkten, sondern insbesondere kam ihm im Tun das Erleben, dass das, was man so an „Realität“ darstellen kann, etwas Vergängliches sei, er aber merke, dass er etwas Unvergängliches in sich trage, das nicht darstellbar sei. Das machte er durch die Lücken deutlich, die seine Fragmente bildeten. An dem Bild entdeckte er zu seinem eigenen Erstaunen seine eigene Religiosität!
In dem, was nichts ist, was als Lücke in der Realität erscheint, entdeckte er sein „Ich“. In dem, was sichtbar ist, drückt sich Vergangenheit ab. Ich bin aber nicht nur der Gewordene. In erster Linie empfinden wir uns als Werdende, als Potentiale, denen wir uns im Leben zu nähern versuchen, vielleicht nie erreichen, die aber unser Handeln bestimmen, darum wirken und eine Wirklichkeit sind, die die Realität verbirgt.
Was in einem intellektuellen Prozess nur partiell gelingt, zeigen solche Bilder in einer tief anrührenden Weise. Solche künstlerischen Reflexionen sind scheinbar dann schon möglich und tiefgreifend, wenn es in dem Alter so noch nicht in einer intellektuellen Form gelingen kann.
Diese Zukunftsseite ist eine schöpferische Seite.
das Memento mori und die Libido
Eine Künstlerin, die als erste die Moderne in Deutschland vertreten hat, die sich oft selber porträtierte, war Paula Becker-Modersohn. Die frühen, mit leichter Hand transparent hingeworfenen Selbstbildnisse mit hohem Wiedererkennungswert stehen in einem eigentümlichen Kontrast zu den späteren Selbstbildnissen, die gröber, dunkler und deutlich verfremdeter sind. Dass es sich nicht um ein Nachlasen der Könnerschaft handelt, ist durch viele Bilder aus der späteren Zeit eindeutig widerlegt. Das Gesicht schwindet oft ins Dunkel, die Hand verschließt den stummer werdenden Mund der immer ernster werdenden Paula, die immer weniger spricht und schreibt. Früher war sie ebenso heiter, wie redselig. Später wird sie eine immer ernster ringende Malerin, von allen verkannt. Immer öfter stellt sie den Leib, als Akt oder Halbakt dar, das Gesicht verliert Bedeutung. Fläche, Farbe, grobe Form – diese treten immer mehr in den Vordergrund bis zu dem großen Halbakt, der sie als Schwangere darstellt zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch nicht schwanger war und in Trennung von ihrem Mann lebte, aber schrieb:
Und dann, weißt Du, es ist solch ein Fest für Frauen, denn diese Mutterbotschaft, sie lebt ja immer noch weiter in jedem Weibe. Das ist alles so heilig. Das ist ein Mysterium, das für mich so tief und undurchdringlich und zart und allumfassend ist (…) Das und der Tod, das ist meine Religion.
Und als Künstlerin erlebte sie sich als Gebärende, die Neues hervorbringt. Das war ihr Selbstbild. Auch die Pflanzen, mit denen sie sich auf manchen Selbstbildnissen umgab, waren Ausdruck von Leben, das sie leben und erzeugen wollte, das ihr Ziel in ihrer Kunst war.
Die fröhliche, mitteilsame, phantasievolle, zu allerlei Schabernack aufgelegte junge Frau wurde zu einer schweigsameren, freiheitsdurstigen und ernsten Künstlerin, die kompromisslos und „rücksichtslos geradeaus“ malte, wie Rilke es nannte. Ohne Vorbild in der Kunst ließ sie sich von den Eindrücken der Natur anregen, malte aber, was von innen dem antwortete, was aus gebrochenen Farben, gestalteten Flächen und vereinfachten Formen bestand. Damit war sie ihrer Zeit um Jahre voraus. Sie gebar einen neuen Stil, den zu ihrer Zeit ihre Kollegen nicht teilen konnten, aber nur wenige Jahre nach ihrem frühen Tod im Expressionismus weitergeführt wurde.
Kompromisslose Ehrlichkeit, tiefe Wahrnehmung der eigenen Stimmung und gnadenlose Offenheit kennzeichneten ihren Stil. Eine echte und tiefe Reflexion, in der indirekt das Memento mori und die Libido auftauchen.
Teil II dieses Vortrages:
Dieser Blick auf uns selber, stolz und kritisch zugleich auf das was ist, aber offen und hoffend auf das, was kommen mag, der aus dem Potential des Möglichen das beleuchtet, was ist, oder weil es misslingt, vielleicht noch nicht ist und deswegen Impulse gibt, dafür, sich seinem königlichen Urbild zu nähern, diesen Blick zeigt uns wiederum Rembrandt:
Nach seinen schwersten biographischen Jahren, die von seinem Bankrott, und dem Tod lieber Menschen, Verlust von Freunden, Wohlstand und Ehre gekennzeichnet waren (seine Lebensgefährtin, die von ihm schwanger ist, wird der Hurerei angeklagt etc.), malt sich Rembrandt 1662 als Zeuxis.
Zeuxis war ein griechischer Maler im 4. Jhd. v. Chr., dessen Werke vielfach beschrieben wurden, aber nicht erhalten sind. Der Sage nach hat er die schönsten Menschen gemalt und von allen das Schönste zu einem Bild zusammengefügt, das so voll Schönheit gewesen sein soll, dass es viele Menschen zu tiefst gerührt hat. Daraufhin habe er sich an die Abbildung der Hässlichkeit gemacht. Im Anblick eines hässlichen Modells, die Schönheit noch im Sinn, soll er den Kontrast nicht ausgehalten haben. Es wird berichtet, er habe sich zu Tode gelacht.
Hier malt sich Rembrandt als Zeuxis. Wir sehen am linken Bildrand ein Bild auf der Staffelei, das eine angedeutet hässliche Gestalt abbildet. Rembrandt hält den Malstab in der Hand. Er malt an dem Bild und fixiert sein Modell – und das Modell ist der Betrachter, wir selbst sind es. Sind wir, bin ich so hässlich? – Und lacht sich Rembrandt angesichts unserer Hässlichkeit zu Tode? Nein! Aber er sieht uns genau, er kennt alle Hässlichkeit an uns, alle Abgründe, alle Tiefen, alle Brüche, so scheint es. Er lacht uns nicht aus. Sein Blick ist milde, aber heiter. Eher ist es, als wollte er sagen: „Das kenne ich alles, ich habe es auch durchgemacht, nichts Menschliches ist mir fremd, mir kannst Du es anvertrauen – und sei beruhigt, das Leben geht weiter! Und die Falten da, schau mich nur an, die habe ich auch…“
Dieser Blick kennt das Memento mori, es kennt den Narzissmus, aber er kennt den Weg dazwischen. Es sieht alles, kann es zulassen und weiß, dass es weitergeht, es hat die Heiterkeit und Freude dennoch, weil es selbst in den Abgründen Quellen dafür sieht, dass es weiter geht.
Paul Celan drückt den Blick, wenngleich mit weniger Humor in seinem Gedicht „Mandorla“ noch anders aus. Die Mandorla ist die Mandel. Und mandelförmig wurden früher Heiligenscheine von Heiligen dargestellt, die nicht nur den Kopf, sondern die ganze Gestalt umfassten.
Sehen wir heute einen Menschen oder uns selber, so sehen wir erst einmal nichts in der Mandel. Wir suchen das Königs-Ich, und sehen erst einmal nichts. Dieses Nichts ist zunächst ein Memento mori. Denn „nichts“, das ist, als existierte etwas nicht.
Hier vermuten wir „den König“, die Königsseite. Wir sehen nichts. Aber wir stehen dazu. Vierzehn mal kommt in diesem kurzen Gedicht das Wort „stehen“ vor, 14 von 81 Wörtern bedeuten „stehen“. Das Auge steht zu etwas, was da steht, was abgeholt werden will von einem Auge, von dem es gesehen werden will. Reflexion ist ein solches Stehen zu sich selber, zu dem was entstehen will, was bestehen kann, Bestand haben wird; eine standhafte Treue zu sich und seinem Königtum ohne Narzissmus, denn Narzissmus entsteht nur, wenn das Gewordene so geliebt wird, dass man die Offenheit für das Neue verliert. Hier ist es die Liebe zur eigenen Zukunft.
Zu reflektieren bedeutet diesem Prozess des Werdens sich zu öffnen. Dieses Werden ist ein sich wandeln und verändern. „Sich verstehen: Ist das eine Entdeckung oder eine Erschaffung?“ fragt Pascal Mercier. Schon sich beobachten, die Voraussetzung zu einem Verstehen sei ein Verändern sagt der französische Philosoph Alain!
Nicht nur modernen Maler wie Picasso, Matisse, bis hin zu Jackson Pollock berufen sich auf Cézanne (geb. 1839 in Aix-en-Provence; gest. 1906), sondern auch Schriftsteller. Rainer Maria Rilke sagte: „An seinen Bildern habe ich dichten gelernt.“ Oder Ernest Hemingway: „An seinen Bildern habe ich gemerkt, was schreiben bedeutet.“ Cézanne suchte – wie ein Dichter in der Sprache – Formen, die sich reimen, beispielsweise eine Badende mit einem Busch dahinter, der die Form von Körper und Kopf aufnimmt. Das ist es, was ein Hemingway bemerkt hatte.
jeden einzelnen Pinselstrich hat er sozusagen durchmeditiert
Das, was Cézanne leistete, konnte er nur, weil er tief ernst und unendlich langsam gemalt hat. Jeden einzelnen Pinselstrich hat er sozusagen durchmeditiert. Seine Motive waren beispielsweise Äpfel – die kullern nicht weg. Menschen zu malen war für ihn sehr schwierig, weil sie sich irgendwann doch mal bewegten. Soziale Kontakte haben in seinem Leben (deshalb) nur gestört.
Wir sehen in dem Portrait (Seite 8) dieses etwas Grimmige, Zurückgezogene, was kaum korrespondieren konnte. Wenn er mit jemand sprach, kamen immer nur abfällige Wortfetzten aus seinem Mund. Irgendwann verlor er völlig die Sprache und verlernte menschliche Interaktion. Er wurde zu einem Einsamen, der, wenn er zu seinem Berg lief, um ihn zu malen, von Dorfbewohnern mit Steinen beworfen wurde.
sich reimende Formen
Auf der einen Seite sehen wir diese grimmige, misanthropische Körperhaltung. Auf der anderen Seite, unter der etwas erhobenen Augenbraue, funkelt ein Interesse hervor, weil er irgendetwas wahrnimmt – eine Farbkombination, oder sich reimende Formen, für die er sich dann doch erwärmen konnte.
es zeigt sich deutlich, dass van Gogh gelitten hat
Sein großer Zeitgenosse Vincent van Gogh ( 1853 in Groot-Zundert; 1890 in Auvers-sur-Oise) lebte eine Zeit lang wenige Kilometer von ihm entfernt in Aix-en-Provence. Sie sind sich aber nie begegnet.
Van Gogh war der Maler der Nacht, malte Sternenhimmel, das Nachtcafé, Spaziergang bei Mondschein. Cézanne war der Maler des Tages, er fing das flirrende, mächtige, erhabene Licht der Provence ein. Er schaute mit einem kritisch, wachen Tagesverstand in die Welt; van Gogh war jemand, der die tiefen, inneren Bewegungen seiner Seele wahrgenommen hatte. Was er an Bewegungen, Mäandern, an Unruhen in seiner Umgebung darstellte, die Pinselführung, mit der er bis in den Bart, bis in die Linien des Gesichtes, bis in das fast verzerrte Auge hinein geht, zeigen deutlich, dass van Gogh gelitten hat. Er wurde in die psychiatrische Klinik von Saint-Rémy eingewiesen und konnte nur entlassen werden, weil es einen fachlich kompetenten Psychiater gab. Sein Bruder hatte diesen gefunden – Paul Gachet, in der Nähe von Paris. Es gibt Aussagen von Doktor Gachet, ungefähr in der Art: „Es geht ihm auch nicht besser als mir; ich weiß auch nicht, was man tun soll.“ Drei Wochen später nahm sich van Gogh das Leben.
Diese unglaubliche Unruhe, die ihn getrieben hat, brachte ihn dazu, in den zehn Jahren seiner Tätigkeit als Maler tausende von Bildern zu malen. Er malte wie ein Berserker. Jeder kennt die Geschichte, als er sich, angeblich nach einem Streit mit Gaugin, das Ohr abschnitt.
mit einer letztgültigen Ehrlichkeit in die tiefen Schichten der eigenen Seele schauen
Das Selbstportrait (siehe Seite 8) ist nicht nur ein Bild, das der Maler von sich entwirft und mit dem er quasi in die Welt hineinschauen möchte, sondern ab Cézanne und van Gogh wird es zu einem Versuch, mit einer letztgültigen Ehrlichkeit in die tiefen Schichten der eigenen Seele zu schauen und in aller Selbstkritik das darzustellen, was nicht zum eigenen Ruhme gereicht, sondern was man als Krankheit ansehen kann.
dieser Blick auf uns selber, auf das, was ist, aber offen auf das, was kommen mag
Dieser Blick auf uns selber, stolz und kritisch zugleich auf das, was ist, aber offen und hoffend auf das, was kommen mag, der aus dem Potential des Möglichen das beleuchtet, was ist, oder weil es misslingt, vielleicht noch nicht ist und deswegen Impulse gibt, sich seinem königlichen Urbild zu nähern – diesen Blick zeigt uns wiederum Rembrandt:
Nach seinen schwersten biographischen Jahren, die von seinem Bankrott, und dem Tod lieber Menschen, Verlust von Freunden, Wohlstand und Ehre gekennzeichnet waren (seine Lebensgefährtin, die von ihm schwanger ist, wird der Hurerei angeklagt etc.), malt sich Rembrandt 1662 als Zeuxis.
Zeuxis war ein griechischer Maler im 4. Jhd. v. Chr., dessen Werke vielfach beschrieben wurden, aber nicht erhalten sind. Der Sage nach hat er die schönsten Menschen gemalt und von allen das Schönste zu einem Bild zusammengefügt, das so voll Schönheit gewesen sein soll, dass es viele Menschen zu tiefst gerührt hat. Daraufhin habe er sich an die Abbildung der Hässlichkeit gemacht. Im Anblick eines hässlichen Modells, die Schönheit noch im Sinn, soll er den Kontrast nicht ausgehalten haben. Es wird berichtet, er habe sich zu Tode gelacht.
das Modell ist der Betrachter: wir selbst
Hier malt sich Rembrandt als Zeuxis (Seite 10). Wir sehen am linken Bildrand ein Bild auf der Staffelei, das eine angedeutet hässliche Gestalt abbildet. Rembrandt hält den Malstab in der Hand. Er malt an dem Bild und fixiert sein Modell – und das Modell ist der Betrachter, wir selbst sind es. Sind wir, bin ich so hässlich? – Und lacht sich Rembrandt angesichts unserer Hässlichkeit zu Tode?
„Das kenne ich alles, ich habe es auch durchgemacht, nichts Menschliches ist mir fremd“
Nein! Aber er sieht uns genau, er kennt alle Hässlichkeit an uns, alle Abgründe, alle Tiefen, alle Brüche, so scheint es. Er lacht uns nicht aus. Sein Blick ist milde, aber heiter. Eher ist es, als wollte er sagen: „Das kenne ich alles, ich habe es auch durchgemacht, nichts Menschliches ist mir fremd, mir kannst Du es anvertrauen – und sei beruhigt, das Leben geht weiter! Und die Falten da, schau´ mich nur an, die habe ich auch…“
Dieser Blick kennt das Memento mori, er kennt den Narzissmus, aber er kennt auch den Weg dazwischen. Er sieht alles, kann es zulassen und weiß, dass es weitergeht. Er hat dennoch die Heiterkeit und Freude, weil er selbst in den Abgründen Quellen dafür sieht, dass es weiter geht.
Reflexion ist ein solches Stehen zu sich selber, zu dem was entstehen will
Paul Celan drückt den Blick, wenngleich mit weniger Humor in seinem Gedicht „Mandorla“ noch anders aus. Die Mandorla ist die Mandel. Und mandelförmig wurden früher Heiligenscheine von Heiligen dargestellt, die nicht nur den Kopf, sondern die ganze Gestalt umfassten.
Sehen wir heute einen Menschen oder uns selber, so sehen wir erst einmal nichts in der Mandel. Wir suchen das Königs-Ich und sehen erst einmal nichts. Dieses Nichts ist zunächst ein Memento mori. Denn „nichts“, das ist, als existierte etwas nicht.
Hier vermuten wir „den König“, die Königsseite. Wir sehen nichts. Aber wir stehen dazu. Vierzehn mal kommt in diesem kurzen Gedicht das Wort „stehen“ vor, 14 von 81 Wörtern bedeuten „stehen“. Das Auge steht zu etwas, was da steht, was abgeholt werden will von einem Auge, von dem es gesehen werden will. Reflexion ist ein solches Stehen zu sich selber, zu dem was entstehen will, was bestehen kann, Bestand haben wird; eine standhafte Treue zu sich und seinem Königtum ohne Narzissmus, denn Narzissmus entsteht nur, wenn das Gewordene so geliebt wird, dass man die Offenheit für das Neue verliert. Hier ist es die Liebe zur eigenen Zukunft.
Zu reflektieren bedeutet diesem Prozess des Werdens sich zu öffnen. Dieses Werden ist ein sich wandeln und verändern. „Sich verstehen: Ist das eine Entdeckung oder eine Erschaffung?“ fragt Pascal Mercier. „Schon sich beobachten, die Voraussetzung zu einem Verstehen, sei ein Verändern“, sagt der französische Philosoph Alain!