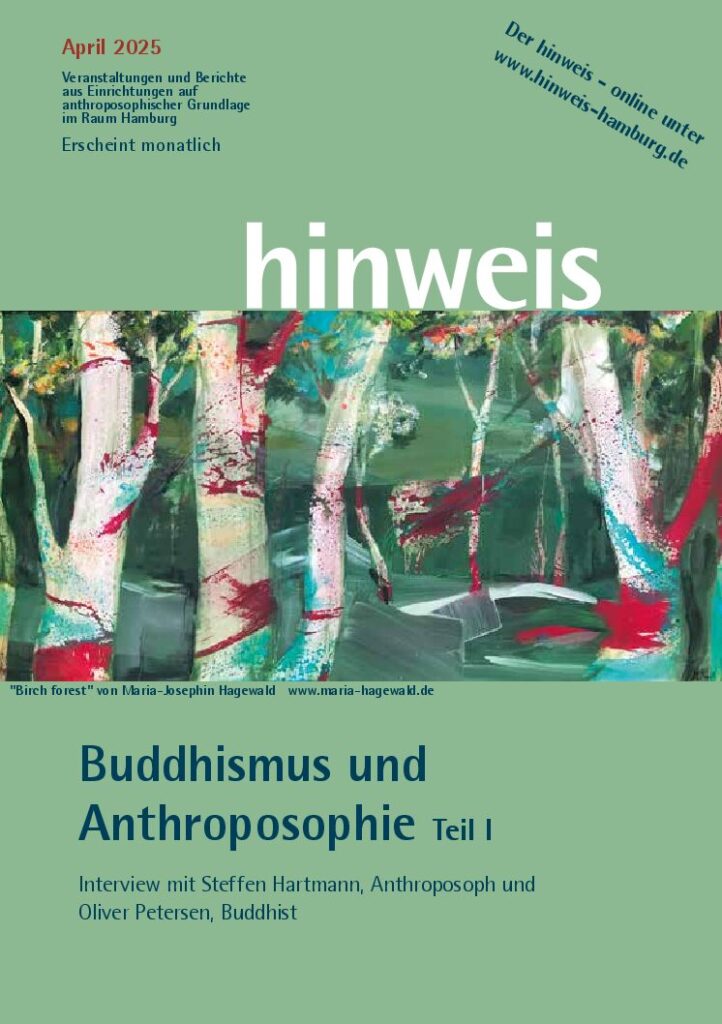Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
Ein Bayer aus Indien
Interview mit dem Komponisten Peter Michael Hamel

Peter Michael Hamel, geboren 1947 in München, gehört zu den vielseitigsten Komponisten und Musikern der Gegenwart. In den 70er Jahren hatte er sich als Mitbegründer der Improvisationsgruppe „Between“ einen Dialog der Kulturen sowie die Überwindung der Spaltung zwischen der so genannten klassischen und der Unterhaltungsmusik zum Ziel gesetzt. Musikwissenschaftliche Studien führten ihn nach Indien, Tibet, Afghanistan, in den Jemen und den Irak – aber auch nach Darmstadt zu den berühmten „Ferienkursen für Neue Musik“, wo er die internationale Avantgarde kennen lernte. Als Autor wurde er einem breiteren Publikum 1976 durch sein Buch „Durch Musik zum Selbst“ bekannt, in dem er dem Zusammenhang von Musik und menschlichem Bewusstsein auf dem Hintergrund umfangreicher Kenntnisse der Weltmusik und der Musikgeschichte nachgeht.
Vor 10 Jahren wurde Peter Michael Hamel als Nachfolger von György Ligeti auf den Lehrstuhl für Komposition und Musiktheorie an die „Hochschule für Musik und Theater“ in Hamburg berufen. Dort erhielt er im Juli anlässlich seines 60. Geburtstages seine jüngste Auszeichnung, den Gerhard Maasz Preis für Chormusik. Als engagierter Kompositionslehrer an der Hochschule wirkend, findet er doch immer wieder Zeit für umfangreiche Kompositionen. Am 1. Dezember wird im Steiner-Haus ein Werk von ihm, „Horch was kommt – Von Ohr zu Ohr“, uraufgeführt werden. Christiane Leiste von ZeitZeichen sprach mit ihm.
Christiane Leiste: Kannst Du was über die Wurzeln Deiner eigenen Musik erzählen?
Peter Michael Hamel: Es gibt eigentlich gar keine eigene Musik, die einem Komponisten gehört, weil Musik nicht Besitz sein kann. Es gibt Wurzeln aus einer Geschichte, mit der man verwachsen ist. Es gibt eine Geschichte, mit der Du aufgewachsen bist. Und so gefragt, würde ich sagen, dass eine Großtante von mir vor dem Ersten Weltkrieg in Leipzig bei Max Reger studiert hat.Und bei der Tante Amalie Jensen Pletsch habe ich schon als ich fünf war, Klavierunterricht gehabt vor meinem Schulbeginn – übrigens mit dem Konstantin Wecker neben mir auf der Schulbank -, bevor ich schreiben lernte, hab ich bereits Noten, Töne, gelernt. Ich habe von Anfang an Töne gleich aufgeschrieben. Das war aber gar nicht in mir verankert. Ich bin ein von der Gehirnhälfte her intuitiv gelagerter improvisierender Mensch, der also nicht mathematische Größen, sondern eher einen Phantasieaufsatz schaffen kann… .
… war das dann keine Vergewaltigung für dich, dass Du gleich Noten lernen musstest, also Punkte mit Tönen gleichsetzten?
Vergewaltigung ist ein bisschen viel, aber es war gewaltig. Eine Herausforderung, welche viel Zeit beanspruchte. Und ich war auch faul beim Klavierüben, so hieß es. Aber ich bin mit dem Werk Robert Schumanns aufgewachsen, denn die Großtante hat sich mit der Rolle der Clara Schumann identifiziert. Ihr Lehrer Uzielli war ja auch der letzte Clara Schumann-Schüler. Und so hab ich von frühester Zeit an die Musik Robert Schumanns intensiv kennen gelernt. Dass ich dann auch mit seinem Wahnsinn aufwachsen würde, hat die Tante jedenfalls erst am Ende ihres Lebens mitbekommen. – Das waren also die Wurzeln im Sinne der klassischen Musik.
Eine andere Wurzel aber war eine akustische, oder besser gesagt akusmatische. Dadurch, dass mein Vater als Regisseur in der Oper wirkte und wir in München gegenüber vom Prinzregententheater wohnten, ging im Prinzip, wie wir das nannten, die gesamte Oper bei uns ein und aus. Z. B. die Harfenistin des Hauses, die wohnte bei uns nebenan. Und ich glaube, dass das unbewusst für mich eine große Rolle spielte, dass die permanent übte, in dem Zimmer neben meinem Babybett. Ja, meine Schwester Sabine wurde noch mehr das Opfer dieses Babybettes mit der Harfenistin, denn sie ist heute Soloharfenistin in Köln, Bayreuth und im Westdeutsche Rundfunk. Und für mich heißt das, dass ich dauernd, auch noch jetzt, in so ursprünglichen Rückführungsträumen, oder, wie man das nennt: Rückführungszuständen, mit der Harfe konfrontiert bin. Und die große Angst vor dem Opernsänger Kurt Böhme, das war ein schwergewichtiger großer Mann, der war ganz lieb, ho, ho, ho, ho, wie der sprach, ich hatte Angst vor dem. Der wohnte bei uns ein Stockwerk tiefer. Ich hatte überhaupt Angst vor den Sängern, vor dieser übertriebenen, künstlichen Sprache.
Das sind die europäischen Wurzeln.
Was für Wurzeln gibt es noch für Dich?
Ich würde sagen, dass ich noch wo ganz anders herkomme, nur das ist nicht eindeutig ortbar. Warum wurde mir in dem Moment, als ich zum ersten Mal eine arabische Oud hörte, oder eine indische Sitar, eine Vertrautheit in mir selbst bewusst – obwohl ich das noch nie gehört hatte? Könnte es das gegeben haben, dass ich das schon vorher gehört hatte? Diese Frage bleibt offen.
gemeinsame Wurzeln zwischen orientalischen und europäischen, antiken Skalen
Gibt es gemeinsame Wurzeln oder Parallelen in der fernöstlichen und der westlichen, europäischen Musik?
Gemeinsame Wurzeln zwischen orientalischen Skalen und europäischen, antiken, wurden von mir erst 1973 wahrgenommen, als ich fast durch einen Zufall merkte, dass etwa gregorianische Tonarten in Indien genauso vorkommen, als sogenannte Thats, sprich Basistonarten. Dass wir also gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Geprägt hat unser Verständnis dieser Zusammenhänge jedoch der Satz von Rudyard Kipling, der Autor des Djungelbuchs, 1899: „East is East and West is West and never the twain shall meet“ – wobei das Wort shall nicht nur werden, sondern auch sollen heißt. Irrtum, Herr Kipling! Es ist nicht so! Auch zu seiner Zeit war es nicht so.
Das ist eine Vorstellung des Imperialisten, der dort hingeht und nach unten guckt, wenn er die Inder sieht. Es gibt eine gemeinsame Wurzel, aber die musste erst erkannt werden.
Und diese gegen-imperialistische Arbeit hast Du ja in Deinem Buch „Durch Musik zum Selbst“ durchgeführt. Inwiefern knüpft nun die Neue Musik an die westliche Tradition an, und inwiefern an die alte, östliche Tradition?
Ja, da stellt sich erst mal die Frage, was ist Neue Musik? Und dann, wie definiert sie sich? – die Neue Musik mit dem großen N. Die Vorstellung Schönbergs, dass die Zwölftonreihe auf den Straßen in hundert Jahren gesungen würde, hat sich nicht ergeben. Es dauert seine Zeit, bis neue Hörgewohnheiten in die Gesellschaft einziehen und das Abenteuer, nicht immer nur in der Gewohnheit zu bleiben, aufgegriffen wird. Nachdem all diese Impulse der Schönberg-Schule in der Nazi-Zeit totgetreten waren, bestand Nachholbedarf und so entwickelten sich kleine Zentren der Neuen Musikszene, und die hatten sich, da muss ich sagen, LEIDER!, mit großen Buchstaben und Ausrufezeichen, eine kleine Elite gebildet. Wir machen das unter uns aus, wir interessieren uns nicht mehr für Hörer. Aus dieser Entwicklung heraus ist eine Spezialkunst entstanden, die niemand wirklich gerne hören will. Denn früher gab’s keine Neue Musik, da gab’s Musik! Mozart war immer Neue Musik, Bach war immer Neue Musik. Dieses Getrenntsein, dass das was Spezielles sei, konnte ich 40 Jahre lang nicht verändern. Ich bin gescheitert. Ich wollte als 20jähriger das verändern. Ich wollte eine Neue Musik ohne das Dogma. Eine Musik schreiben, die alle verstehen, ohne mich anzubiedern, ohne mich sozusagen zu verkleinern, zu verblöden, zu vereinfachen, es wäre gegangen, es wurde nicht gewollt. Man war ganz zufrieden mit der elitären Situation. 99, 9% derjenigen, die Neue Musik schreiben, interessieren sich ja nicht für zuhörende Menschen.
Wie kommt es, dass Du das anders siehst?
Ich hatte ein großes Glück in der Findung eines Lehrers, oder er hat mich gefunden, Fritz Büchtger (1902 –1978). Er war übrigens ein Anthroposoph. Der hat das Studio für Neue Musik so organisieren wollen, dass es Menschen anzieht. Obwohl es doch schwierige Musik ist. Über Vermittlung, über Sprechen, über Das-Stück-zwei-Mal-spielen, über Ausschnitte-spielen, „Haben Sie mal Geduld, das wird schon, so schwer ist das nicht, gucken se mal, so ist das aufgeschrieben…“ – also eine große didaktische Bemühung.
Hat denn Deine Musik etwas mit dem ganz konkreten Leben zu tun?
Tolle Frage. Danke für die Frage. Muss ich ´ne Pause machen. – Ich hoffe, ja. Ich hoffe, dass das mit meinem Leben zu tun hat. Aber inwiefern? Glücklich sein und verzweifelt sein. Ja. Mit Angst, mit Zuversicht, mit Wunsch nach Angstüberwindung, in einem guten Sinne auch Vermittlung, Dialog der Kulturen, der Wunsch nach Friedlichkeit. Das wären alles Lebensfragen, auch im Alltag, mit der Familie, mit den Kindern, und auch in der Hochschule hier, insofern hat es damit zu tun.
Was heißt das jetzt konkret, also wie hat das jetzt mit Angst, mit Verzweiflung und so weiter zu tun?
In dem Stück mit dem Kontrabass, das jetzt im Dezember im Steiner Haus bei Euch uraufgeführt wird, da gibt’s das alles auch: Krise, Krach und Aversionen, und nicht mehr sich anschauen, Wut, Selbstzerstörung, und die Überwindung all dieses zugunsten einer größeren Einvernehmlichkeit. Im Grunde ist die Frage beantwortet mit: ich möchte mich selber aushalten können, und deswegen komponiere ich.
Meine Musik spielt sich in meinem Kopf ab oder in meinem Herzen
Und wie komponierst Du eigentlich? Also, setzt Du Dich ans Klavier, oder…
Nein, ich sitze nicht am Klavier, das kommt ganz selten vor. Meine Musik spielt sich in meinem Kopf ab oder in meinem Herzen. Also, beim Schwimmen komponiere ich manchmal. Wenn ich im Kaifu-Bad schwimme und meine Runden drehe, da komponier´ ich schon mal was. Oder am besten in Ibiza, im Meer, oder – als Bild – wenn die Zikaden zickern, tschk, tschk, tschk, tschk, und ich den Moment der absoluten Ruhe kurz aushalte, selbst aushalte, dann komponiert es. Und dann bin ich auch nicht der, der das macht. Es ist durch mich hindurch entstanden. Ich bin vielmehr so ein ganz altertümlicher medialer Schamane, durch den etwas geschieht, als dass ich das leiste, mache, bewerkstellige.
Manchmal denke ich, das hab ich gar nicht selbst und alleine hingekriegt. Und ich habe auch große Probleme mit meinen eigenen Stücken nachher, dass ich sie weiß Gott nicht so gerne alle wieder anhören mag.
Warum eigentlich?
Das ist dann was anderes geworden. Auskomponiert ist es nicht mehr da.
Also, wenn Du schwimmst, oder wenn Du den Zikaden zuhörst, dann hast Du die Musik, empfängst die Musik, und dann gehst Du ins Zimmer und schreibst alles schnell auf?
Ja, aber, nicht so schnell. Das ist dann schon eine große Mühe, ist auch `ne Riesendisziplin, `ne Frühaufstehernummer, das ist immer noch für mich Bleistift und Radiergummi. Ich schreibe, wie ich zeichne, also es hat auch was mit der Grafik zu tun.
Und wenn Du dann schreibst, hast Du das ganze Stück schon vor dir, oder musst Du noch überlegen?
Gute Frage, natürlich, immer, das ist mir völlig klar, was Du fragst, weil das ist schwer zu erklären. Das muss ich jetzt ein bisschen vermitteln. Was ist heute, Juni?
29. Juni
Ist nicht zu glauben! Am 29. Juni ist Peter und Paul. Das ist mein, wie nennt man das, Peter, nicht Geburtstag, sondern…
Namenstag
… Namenstag. Da war 1964 in Bayern schulfrei wegen diesem Peter und Paul. Da war ich im Schwimmbad und hatte mir für 14 Mark die Studienpartitur von Bartóks Konzert für Klavier und Orchester II gekauft, von Boosey und Hawks, eine grüne, kleine Studienpartitur. Heute vor …
43
… 43 Jahren! Und ich hab im Schwimmbad gelesen, diese Partitur, und hab den 2. Satz, wie das Streichorchester da anfängt, plötzlich gehört. Nicht, weil ich’s am Klavier gespielt hätte, sondern ich hab’s in mir gehört. Da war ich 16 oder so.
Stark!
So schreibe ich heute alles, was einigermaßen überschaubar ist, erst auf, wenn es vollkommen fertig in meinem Kopf ist
Und abends wird das Konzert gespielt mit Eschenbach als jungem Solisten. Hey, heute, vor so und soviel Jahren, whatever! Und in dem Moment dacht´ ich: „Moment, das was ich mir klanglich vorstelle, kann ich lesen, und das was ich lesen kann, kann ich mir innerlich hörend vorstellen!“ Der Abend hat den Beweis erbracht. Und so schreibe ich heute alles, was einigermaßen überschaubar ist, erst auf, wenn es vollkommen fertig in meinem Kopf ist.
Aber vergisst man dann nicht wieder ´nen Teil?
Ja klar, das ist eben die Disziplin, am Ball zu bleiben. Also als Hochschullehrer, gleichzeitig komponieren, dienstags unterrichten, mittwochs Hochschule – das kann ich nicht. Ich muss in ein Retreat, ich muss raus. Deswegen, Zikaden ist nur ein Symbol, Schwimmengehn, das ist Symbol für Dekonditionierung des Wahrnehmungsprozesses, um dann in der Situation so offen zu sein.
Andere improvisieren und schreiben das dann anschließend nach dem Tonband auf …
… improvisieren, um einen unbescholtenen, ohne sein Bewusstsein, aus dem Jetzt heraus entstehenden Zustand erstehen zu lassen. Oder John Cage, der sagte: „Ich möchte gar nicht verantwortlich sein für mein Tun.“ Er hat sogar Zufallssituationen wie Würfelspiele organisiert, dass es von selber passiert, und dass nur ja nicht sein Ego eine Rolle spielt. Er wollte zurücktreten vor dem Werk. Das ist nicht so richtig verstanden worden.
Zum Teil ist es doch so, wie du vorhin gesagt hast, dass sich die Hörgewohnheiten ändern müssen.
Ja, das geht aber langsamer, als man es gerne hätte, obwohl jetzt alle das Wort Musikvermittlung im Mund haben. Wir müssen Konzertformen finden. Und das hat gar nichts mit neu oder alt zu tun. Wir denken darüber nach. Wir an der Hochschule, logischerweise, überlegen mit unserem Präsidenten Elmar Lampson zusammen: „Wie können wir junge Leute bewegen, inspirieren, dass die so genannte klassische Musik nicht verloren geht?“
Und was habt Ihr für Ideen dazu?
Ja, da gibt´s schon gute. Da gibt’s schon viele. Und mit dem Landesmusikrat, mit der Jugendmusikschule wird sehr viel gemacht, das neue Komponieren ist auch ein Teil davon. Wir haben
z. B. 14, 15 jährige Komponistinnen und Komponistenschüler in der Jugendmusikschule drüben, im Mittelweg. Und wir haben Kommunikation, dass wir einer neuen Generation offen gegenübertreten. Und ich bin auch auf der andern Seite, durch meine Vielseitigkeit, dass ich nicht nur E-Musik mache. Da ist immer diese Trennung, die ich nicht geschaffen habe, zwischen E und U, Ernst und Unterhaltung. Wir müssen vielleicht ganz andere Veranstaltungsformen finden. Wir müssen einem Komponisten beibringen, gescheite Tatortmusik, gescheite Rockmusik zu schreiben. Dass mehr Geschmack ist für die Musik im Fernsehen. Das nicht einfach verdrängen, sondern dort muss Qualität entstehen.
Du hast vorhin erzählt, von den Zikaden, es war nur ein Bild, sagst Du, aber: ist es für Dich wichtig, wo Du Dich aufhältst, in welchem Land, in welcher Stadt, zum Komponieren?
Ja, es ist irgendwie ein altes Ritual, ich muss Voraussetzungen haben, wie Schiller seinen faul riechenden Apfel hatte. Ich muss raus, ich muss in einen freien Raum kommen – mit den Voraussetzungen der Dekonzentrierung, Dekonditionierung des Alltags. Da kann ich auch mit Kindern, mit meiner Familie nicht viel anfangen. Die schenken mir diese Zeit auch. Das sind übrigens manchmal nur drei Wochen im Jahr. Aber dann ist plötzlich eine ganze Symphonie fertig.
Und wo bist Du da?
Da bin ich im Retreat, in der Zurückgezogenheit, wenige Wochen im Jahr, da hab ich zum Glück einen Platz. Den halt ich auch geheim, da will ich nicht gestört werden. Der größte Urlaub ist komponieren. Das ist nämlich das größte Glück, das größte Geschenk, dass Du das machen darfst, was Du selber willst. Keine entfremdete Arbeit.
Wunderbar! Das Werk, an dem Du gerade arbeitetest, kreist um das Thema Nahtoderfahrungen. Kannst Du den Kompositionsprozess an diesem Beispiel noch deutlicher machen?
Also das Thema Nahtoderfahrungen ist eine Suche, nicht über eine esoterische oder religiöse Befangenheit oder Befasstheit ein Thema anzugehen. Die Tibeter haben eine Welt, die Anthroposophen eine Welt, das kann man Glaube nennen oder Wissen oder Ahnen und Erinnern. Was ich komponiere ist Trostarbeit.
Und was komponierst Du da?
einen Ton finden, der über das Leben hinausgeht
Ich versuche meine musikalischen Mittel einzusetzen, einen Klang, einen Ton zu finden, der über das Leben hinausgeht. Und das hab ich immer schon versucht, z. B. in meiner Oper „Ein Menschentraum“. Da ist dann ein Moment, da stirbt der Dichter in den Armen seines Adam, der Gestalt, die er geschaffen hat und sagt: “Das Licht war stark, nun blendet es, halte mich, Adam“, dann gibt es ein tableau vivant, alle verharren starr, sieben Minuten lang. Was hab ich da gemacht? Die Obertonreihe instrumentiert. Es gibt natürlich auch andere Komponisten, die in dieser Weise diesem Thema sich genähert haben, z. B. Carl Orff, mit dem ich in den Siebziger Jahren gut befreundet war und der mich da stark beeinflusst hat. Er hat das in seinem großen Alterswerk »De temporum fine comoedia – Das Spiel vom Ende der Zeiten« gemacht.
Oder Olivier Messian in seiner Franziskus Oper. Und Morton Feldman mit dem Versuch der Annäherung an die Unendlichkeit in seinem letzten Orchesterwerk Koptisches Licht. Ein Orchesterstück, wo ein Klang bleibt, in sich steht. Man kann das eigentlich konzertant gar nicht aufführen. Nach einer Minute denkt man „was ist jetzt?“, aber es bleibt so.
Wie lang?
Ja, das geht beim Feldman im Orchester nur eine halbe Stunde. Das ist wahrscheinlich die größte Chance, als Komponist an die letzten Dinge zu kommen. Dieser Klang, den kannst du ja mit geschlossenen Augen in dir erleben, du bleibst ja als Hörender übrig. Und was weißt Du, was in deinem Bauch war, wo deine Kinder hergekommen sind. Da haben sie vorher gehört, bevor sie gesehen haben, bevor sie geschmeckt haben, schon mit viereinhalb Monaten. Das Hören ist das erste und das letzte.
Du hast ja auch das Stück, „Der Klang des Lebens“ geschrieben…
Das war der Versuch, natürlich, genau das Thema aufzugreifen.
Also, das Vorgeburtliche?
Ja.
Und ist das das gleiche, wie das Nachtodliche?
Na, das gleiche, das ist ja so schwer gesagt. Aber es gibt diese Vision, die im Tibetanischen Totenbuch niedergelegt ist, in dieser für mich, neben der Bibel, wichtigsten Schrift, dass Du also mit was ankommst. Du kommst nicht als Nichts an. Du wählst Dir den Ort, die Eltern. „Der Klang des Lebens“, das ist ein Zitat, ein Buch von Alfred A. Tomatis, der als Forscher, als Arzt herausgefunden hat, dass ein Embryo schon was hört. Also rein was Physiologisches.
Ja, aber Du hast das doch nicht „rein physiologisch“ komponiert.
Ja, ich sag´ nur, das ist der Titel. Das Problem vom „Himmel vertonen“, oder vom Geistigen, vom Licht oder von Friedlichem als Thema des Komponierens ist, dass es nah am Kitschigen sein kann. Weil es immer alles missbraucht ist, nicht? Die Nivellierung. Dass die geistigen Dinge so zu haben sind, so mal eben, das will ich nicht.
Neu ist eine völlig neu zusammenhängende Situation, die jeder für sich schafft – ein ganz neuer Blickwinkel
Was ist das Neue an Neuer Musik?
Es gab seit Schönberg viele zum Teil extreme Versuche und Überbietungsversuche. Ich würde, nach all dem sagen: Neu ist eine völlig neu zusammenhängende Situation, die jeder für sich schafft. Ein ganz neuer Blickwinkel. Das ist neu. Insofern kann Musik Brücken bauen.
Was für Brücken kann Musik bauen?
Musik als Konzerterlebnis schafft das Einverständniserlebnis von Hörern, die etwas zusammen vernehmen und in einer Form von intersubjektiver Betreffbarkeit miteinander das Gleiche gut oder nicht gut finden. Das ist schön. Das ist eine Brücke.
Eine andere Brücke wäre, und das ist bereits meine Form von Utopie: Brücken der Kulturen. Dialog der Kulturen wäre für mich eine Brücke der Neuen Musik, der Musik überhaupt, des Musizierens. Wenn wir was hören, was da einer spielt, und wir finden alle gemeinsam, dass das schön ist, dann haben wir einen Zusammenhang, das ist wie ein Liebesakt, das ist wie Zärtlichkeit, das ist wie etwas ganz Wunderbares und Frieden Stiftendes. Also das ist dann der Zusammenhang zwischen Menschen, der erst dadurch entsteht, dass sie gemeinsam ein spätes Beethoven Streichquartett hören oder einen indischen Raga.
Was ist Dein besonderes Anliegen, das Du als Kompositionslehrer vermitteln willst?
Sich selbst finden und sich selbst dann, wenn gefunden, falls gefunden, treu sein.
Gibt es so was wie eine „Hamelschule“?
Nein. Es gibt keinen, der mich imitiert. Dafür hab ich gesorgt. Also, meine Unterrichtsform ist: jede(n) anschauen als einzelne(n). Es ist anstrengender, mit Sicherheit, es erfordert mehr Empathie. Ich stell auch vieles in Frage. Dass es so nicht geht, dass es keine Gewohnheiten gibt, aber ich tue das (auch) mit mir selber. Also, existentielle Fragestellungen, Infragestellungen. Keiner ist wie der andere.
… dass Musik nicht über Noten und die Augen, sonder über das innerlich Gehörte entsteht
Jetzt musst Du nur noch was über Dein Stück erzählen, das am 1. Dezember bei uns aufgeführt wird.
„Von Ohr zu Ohr“, das ist schon ein Prinzip. „Von Ohr zu Ohr“ ist die Idee, dass Musik nicht über Noten und die Augen, sonder über das innerlich Gehörte entsteht.
„Horch was kommt“ ist natürlich (singt) „horch was kommt von draußen rein“. Wer kommt? Die Grundidee ist: zwei treffen sich, lieben sich. Es ist auch `ne Beziehungsfrage. Es kommt ein Mensch auf einen andern zu, sie nähern sich an, und alles was miteinander kommt, beieinander, nacheinander, hintereinander, nebeneinander, gegeneinander, ist immer, jedes Mal, Miniatur. Suitenartig. Kleine Stücke. Immer zwei Seiten, so dass sie das immer auf dem Notenpult haben ohne umblättern zu müssen: Erst mal kommen sie aufeinander zu, und am Schluss gehen sie voneinander weg.
Ich hab einmal in München ein Stück geschrieben, das hieß Ananda. Das hat mit „einander“ gar nichts zu tun. Das ist ein Sanskritwort, das heißt Glückseligkeit. Yogananda. Und da hab ich dem Professor Orff gesagt (spricht bayrisch): „Des is jetzt des Ananda für Oboe und …“ – “Ja wos hoaßt jetzt des – Ananda?“ Sag ich:„Herr Professor, das heißt Glückseligkeit“. Er sagt zu mir:„Ach so! Beiananda, aufananda, inananda … .“ Der alte Achtzigjährige! … Es hat aber tatsächlich mit Nähe zu tun, auch mit erotischer Energie, mit Abstoßung, mit Aneinander-sich-ausrichten. Es gibt musikalische Formen wie Heterophonie, hintereinander her, wie Polyphonie, übereinander. Das ist alles in jedem kleinen Stück geformt. Und alles geht auf die große Einverständniserklärung hinaus, dass im Klangspektrum eines Kontrabasses neben den tiefen e das hohe e der Violine bereits enthalten ist, dass sie beide also ganz am Schluss wissen müssen, dass sie sowieso aus ein und demselben Stoff sind. Das wäre die Friedensbotschaft.
Der Kontrabass steht natürlich logischerweise in der Mitte, wie so ein Urbauch, der da ist. Dann kommt von außen sozusagen sein Flugobjekt und geht dann auch wieder weg. Inszenieren müssen wir das noch in dem Raum. Also, das ist auch theatralisch, es ist aber Annäherung und Entfernung. Es ist im Grunde ein Beziehungsdrama. Das ganze Stück. Also Drama mit gutem Ausgang, oder mit schlechtem Ausgang, aber sie streiten sich, im vorletzten Stück streiten sie sich erheblich, und dann geht die Violine wieder weg! Sie geht ja wieder nach draußen. Und wenn’s kein Bass wäre, wenn’s ne Bratsche wär´, dann würd´ ich die Bratsche auch woanders hingehen lassen … würde ich sie beide weglaufen lassen. Aber so ist es irgendwie, es ist noch mal ein anderes Bild für mich. Der Kontrabass ist das Väterchen Frost, also es ist irgendwie so eine Instanz von Wärmepegel, an dem man sich messen kann. Ich weiß natürlich nicht, wie die beiden Musiker das machen. Und auch, wie ich das im Zusammenhang so als Geschichte vermitteln kann. Weil ich möchte, dass sich das direkt aus der Musik ergibt und nicht aus dem Vorwort.
Ja, es macht neugierig … Danke für das Gespräch!
Bearbeitung des Textes: Christiane Leiste