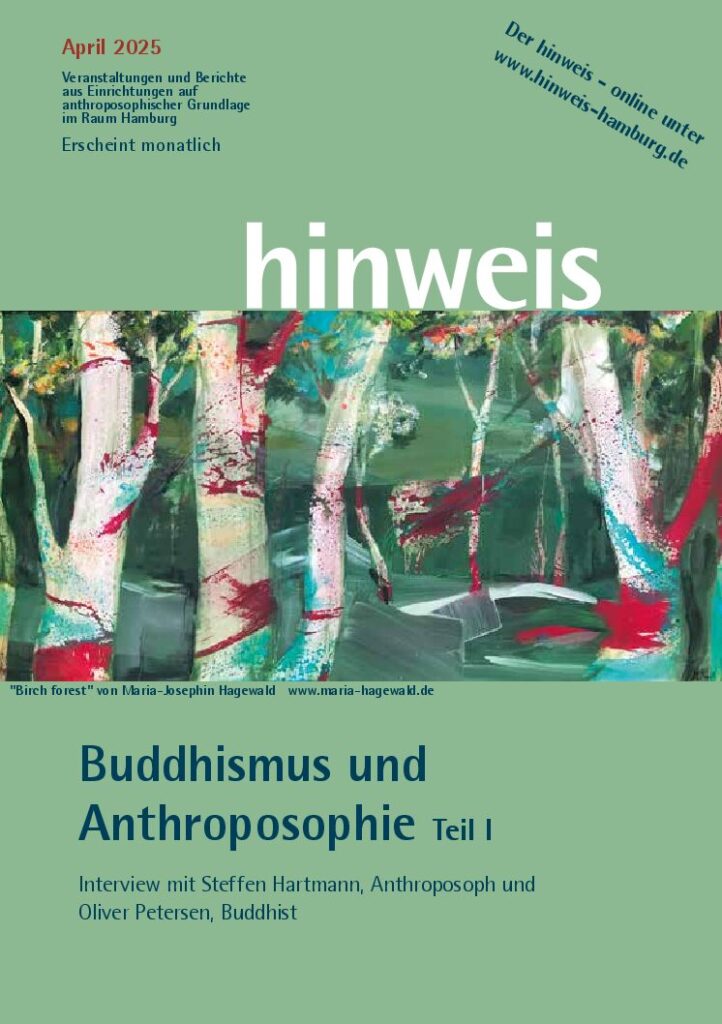Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
Junge sein und Mann werden – Abenteuer oder Katastrophe? (Teil I und II)
Interview über Jungenpädagogik mit Ulrich Meier, Pfarrer der Christengemeinschaft

„Jungen brauchen eine andere Pädagogik als Mädchen“ – diese Erkenntnis wird in den letzten Jahren immer populärer. Etwa seit 1990 ist bemerkt worden, dass Jungen in ihrer Kindheit und Jugend nicht nur mehr Schwierigkeiten machen, sondern sie auch haben. Alle Störungen, die ein Kind in der Zeit des Heranwachsens haben kann, sind bei Jungen bis zu zehnmal häufiger vertreten als bei Mädchen – was Eltern und Pädagogen häufig an den Rand ihrer Fähigkeiten bringt. Doch wie fasst man Jungen anders an? Was steckt dahinter, wenn sie cool, aggressiv, beängstigend sind? Welche Orientierung können sie heute bekommen durch die Welt der erwachsenen Männer, die ebenfalls in einem Umbruch ist?
Ulrich Meier, 1960 in Hamburg geboren, Waldorfschüler; in seiner Herkunftsfamilie hatte er sechs Brüder und zwei Schwestern. Seit August 2006 wieder in Hamburg in der Leitung des Priesterseminars und als Pfarrer in Hamburg-Mitte. Mitarbeit in der Redaktion „Die Christengemeinschaft“. Vater von fünf Söhnen. Autor von Büchern zum Thema Männer, Kindheit und Jugend.
Christine Pflug: Welche beruflichen Erfahrungen haben Sie mit Jungen und Männern?
Ulrich Meier: Vor dem Studium am Priesterseminar habe ich in Hamburg eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher gemacht und war dabei Anfang der 80-er Jahre u.a. in der Jugenduntersuchungshaftanstalt Vierlande tätig. Dort waren Jungens zwischen 14 und 20 Jahren, viele davon Migranten. Zunächst denkt man, die Jungens im Knast seien extrem, aber sie sind eigentlich ganz normal.
In Schloss Hamborn habe ich dann 11 Jungen im Alter von 13 bis 18 Jahren in einer Internatsgruppe betreut. Grundsätzlich ist die Ausbildung zum Erzieher altersübergreifend, insofern habe ich kurze Zeiten in einem Spielplatzheim und auch in einem Kindergarten gearbeitet.
Als Gemeindepfarrer in Hannover habe ich weitere 10 Jahre freie Jugendarbeit in Form einer Theatergruppe gemacht. Später habe ich dann zusammen mit einigen anderen eine Männergruppe aufgebaut.
„Kleine Helden in großer Not“
C. P.: Wie sind Sie zu dem Thema Jungenpädagogik gekommen?
Ulrich Meier: Interessanterweise auf Umwegen. Ich hatte gar nicht zur Kenntnis genommen, dass seit Anfang der 1990-er Jahre darüber neu nachgedacht und geschrieben wurde. Über eine verzweifelte Frage von mir zum Thema „sexualisierte Gewalt“ trat in einem Gespräch mit Mathias Wais bei mir die Frage auf, was man präventiv tun könnte. Da fiel für mich zum ersten Mal das Stichwort „Jungenpädagogik“ und die Einsicht, dass man mit Jungen ganz anders umgehen muss, wurde immer stärker.
Damals habe ich angefangen, die entsprechende Fachliteratur zu lesen: Dieter Schnack und Rainer Neutzling „Kleine Helden in großer Not“ und „Der Alte kann mich mal gern haben“.
C. P.: Was ist heute bei den Jungen so schwierig? Wie zeigen sich diese Schwierigkeiten?
U. Meier: Wenn man sagt, Jungens seien schwierig, hat man anfangs oft eine subjektive Perspektive, d. h. man kommt mit ihnen weniger gut klar als mit Mädchen. Dass Jungen in ihrer Kindheit und Jugend mehr Schwierigkeiten haben, ist eben erst neuerdings beachtet worden. Im Moment boomt der Informationsmarkt über die Schwierigkeiten der Jungen. Grundsätzlich kann man sagen: Alle Schwierigkeiten und Störungen, die ein Kind in der Zeit des Heranwachsens haben kann, haben Jungen bis zu zehnmal häufiger als Mädchen, mit Ausnahme der Magersucht. Das ist die einzige Störung, die mehr bei Mädchen vorkommt.
Die Jungen sind das benachteiligtere Geschlecht in der Zeit des Heranwachsens, und ein Teil davon ist zivilisatorisch bedingt.
Den Jungen fehlt das Abenteuer im Alltag
C. P.: Was ist der Anteil der Zivilisation, die es den Jungen so schwer macht?
U. Meier: Wir haben – und wollen – eine Welt, die über Kommunikation und Verständigung funktioniert . In diesen Bereichen haben es Mädchen traditionell einfacher. Ich glaube, was den Jungen am meisten fehlt, ist das Abenteuer im Alltag.
Eine weitere mögliche Erklärung könnte in dem Bedürfnis unserer Gesellschaft nach Grenzenlosigkeit liegen. Unsere Zivilisation duldet am liebsten keinerlei Eingrenzung mehr: man kann an den entferntesten Punkt der Welt reisen, sich die Nacht zum Tag machen, in den Supermärkten gibt es ein grenzenloses Warenangebot. Früher hatte man kleine Läden, in denen eine mannshohe Theke die Sehnsüchte des Kindes von der zu schnellen Erfüllung massiv trennte.
Die heutige Erziehung unserer Kinder richtet sich nach dieser Grenzenlosigkeit aus. Dabei wird vergessen, dass jede Begrenzung uns auch Orientierung schenkt, „an jeder Grenze erwache ich!“
Jungen lernen immer an der Grenze
C. P.: Ist das „Erwachen an der Grenze“ bei Jungen ein besonderes Thema?
U. Meier: Jeder, der mit Jungen zu tun hat, kann folgende Beobachtung machen: In einer gemischten Gruppe gibt es immer fünf bis sechs Jungen, die einem als Betreuer das Leben schwer machen. Dieter Schnack und Rainer Neutzling haben eine Schulklasse auf einem Ausflug als Beobachter begleitet und hatten das übliche Bild: Es waren 30 Kinder und fünf von den Jungs beanspruchten zwei Drittel der Aufmerksamkeit von den Betreuerinnen. Schnack und Neutzling haben nicht danach gefragt, wie man das abstellen kann, sondern warum diese fünf Jungen dieses Übermaß an Beachtung brauchen. Sie kamen dabei zu der Beobachtung, dass Jungen immer an der Grenze lernen. Sie sind nicht bereit, in einem „weichen“ Einvernehmen zu lernen, sondern suchen stärker eine „harte“ Klarheit an den Grenzen. Sie erleben den anderen oft erst, wenn sie an die Grenze gekommen sind. Das hat zur Folge, dass sie in Schulen und auch Zuhause ihre Aufmerksamkeit häufig negativ bekommen, weil sie dabei Grenzen überschreiten.
Die alten Männerbilder sind verpönt
C. P.: Wenn man sich mit Jungen beschäftigt, stößt man automatisch auf das Thema Männerbild. Welche Männerbilder haben wir heute?
U. Meier: Die alten Männerbilder sind verpönt – und neue lassen sich nicht verallgemeinernd beschreiben. Dadurch haben Jungen auch keine genügend klaren Vorbilder, in die sie hineinwachsen können. Oftmals nehmen sie sich dann Zerrbilder und überstarke Heldenbilder, die sie nicht an der Realität ausrichten können, weil die wirklichen Männer im Alltag der Jungen nicht genügend präsent sind.
Wir wissen heute sehr genau, welche Art Männer wir nicht haben wollen: Machos, das heißt, wir wollen keine Männer, die schweigen, die Macht ausüben; oft geht es schon bei den Kindern los: wir wollen nicht, dass sich Sieger freuen dürfen und Verlierer sauer werden. Aber es ist schwer zu formulieren, was dann noch vom Mann übrig bleibt und was das positive Bild ist. Die Jungens haben oft eine sehr starke Sehnsucht nach klaren Männerbildern und ecken damit bei ihren weiblichen Erziehungsberechtigten an.
C. P.: Was sind klare Männerbilder?
König, Magier, Krieger und Liebhaber
U. Meier: Klar sind zunächst die alten Vorstellungen von jemandem, der alleine zurechtkommt, stark ist, ein Kämpfer ist. Für neue klare Bilder gibt es Anregungen, zum Beispiel in dem schönen Buch „Männer-Quest“ von Reinhold Hermann Schäfer, in dem beschrieben wird, wie der Mann nach sich nach vier Richtungen finden und entwickeln kann: die eine ist der König, der als Schatten den Diktator hat; die andere ist der Krieger, der hat als Schatten den Killer; die Dritte ist der Magier, der hat als Schatten den Manipulator; die vierte ist der Liebhaber mit dem Schatten des Süchtigen. Die beiden letzten, Magier und Liebhaber, sind die mehr weiblichen Seiten des Mannes, und Krieger und König sind die mehr männlichen Seiten. Ein günstiges, produktives Bild des Kriegers und eines berechtigten Königs lässt sich heutzutage sehr schwer beschreiben.
Die Frauen haben durch die Emanzipationsbewegung unglaublich viel Arbeit geleistet, sich selbst zu klären und zu entwickeln. Sie wissen, was sie nicht mehr wollen und was sie im Positiven anstreben. Diese ganze Bewegung haben die Männer angeschaut, waren aber wie die Kaninchen vor der Schlange und sind selbst nicht in Gange gekommen, jedenfalls selten in Gemeinschaft. Einige haben versucht, weibliche Anteile zu entwickeln. Bei einigen war das überzeugend, bei anderen auch nicht – man spricht dann von Mappies, also Pappies, die nicht wirklich Männer sind; man vermisst das Konturierte. Dann gab es eine kleine Männerbewegung als Antwort auf die Frauenbewegung, Walter Hollstein in den 1980-ern gehört dazu, aber die ist kaum bemerkt worden. Es steht immer noch die Klärung an „Was will ich als Mann sein?“ oder als Frau „Welchen Mann will ich als Partner haben?“
Männer reden lieber wenig bis gar nicht
C. P.: Nun fällt es Frauen leichter, sich auszutauschen, mit anderen über sich zu sprechen, sich in Gruppen zu reflektieren. Bei Männern braucht es einen wesentlichen Leidensdruck, bevor sie damit beginnen. Woran liegt das? Ist das nur konstitutionell bedingt?
U. Meier: Mit Konstitutionsbestimmungen bin ich immer eher vorsichtig, denn ich glaube, dass die durch Erziehung weitergegebenen Rollenklischees viel bewirken. Für den mangelnden Austausch der Männer untereinander etwa gibt es das viel beklagte Schweigen: Männer reden lieber wenig bis gar nicht. Das schlimmste, was man als Mutter einem Jungen nach der Schule antun kann, ist die Aufforderung: „Jetzt erzähl doch mal!“ Je mehr man zeigt, wie schön das Reden ist, desto mehr igelt er sich ein. Da zeigt sich die große Angst schon der Jungen vor Öffnung..
Ein anderer Punkt ist, dass Männer es sich häufig nicht so leicht erlauben, sich aktiv um sich selbst zu kümmern. Das würde voraussetzen, dass sie in dem Spannungsfeld zwischen Mutter und Partnerin zurechtkommen. Aber da gibt es noch viel Unreife. Ich muss als Junge und Mann einen komplizierteren Weg zur eigenen Identität gehen, weil die erste Bezugsperson in der Familie, und meistens auch noch in der Schule, eine Frau ist und die erwachsenen Männer zur Unterstützung der eigenen Identität nicht so präsent sind. Ich glaube, dass die unreife Haltung der Männer, die Partnerin als Mutter zu sehen – „Meine Frau erledigt die Kommunikation und die Kontakte, besorgt die Geschenke für meine Patenkinder usw.…“ – noch sehr stark da ist.
C. P.: … und es ist einfach bequemer und bedarf einer Anstrengung, die andere Rolle aktiv zu übernehmen. Genauso, wie es für uns als Frauen auch bequemer ist, die Autobatterie vom Mann aufladen zu lassen.
U. Meier: Natürlich passt da die Faust aufs Auge, denn natürlich gibt es auch bei Frauen Unreife in der Entwicklung. Sie haben oft noch aus alten Frauenbildern heraus gelernt: man muss dienen, versorgen. Der emotionale Versorgungsbedarf der Männer trifft in klassischen Konstellationen auf die Bereitschaft der Frauen. Und das kennt man aus der Beratungspraxis: Männer kommen häufig erst dann in eine Gruppe oder Therapie, wenn sie sich völlig leer fühlen.
C. P.: Es ist auch eine gegenseitige Abhängigkeit, die man damit schafft. Selbst wenn „frau“ sich über den mangelnden Entwicklungswillen des Mannes beklagt, vermittelt es Sicherheit, da man ja für die emotionale Versorgung gebraucht wird.
… „mann“ möchte lieber eine perfekte Außenseite zeigen
C.P.: Sie sprachen von der Angst, die dahinter steckt, wenn Jungen und Männer nicht über sich reden wollen. Wie ist die zu sehen?
U. Meier: In der Kommunikation teile ich mich mit und mache mich sichtbar, so wie ich bin, unfertig, schwach oder auch stark, lustvoll. Und das fällt schwer. Jungs und Männer möchten lieber eine perfekte Außenseite oder eben einen Panzer zeigen, eine fertige, gute, tolle oder auch „coole“ Gestalt. Aber wenn man noch nicht fertig ist, fällt es schwer sich zu zeigen, denn man ist ja angreifbar. Man hat nicht das Vertrauen, dass der andere die eigenen Schwächen und Unfertigkeiten gut aufnimmt, sondern es steht die Angst dahinter, dass alles, was man sagt, gegen einen verwendet wird.
C. P.: Bei Mädchen in diesem Alter ist es genau das Gegenteil: je mehr sie sich mitteilen, desto mehr Zuwendung und Anerkennung bekommen sie.
U. Meier: Jungen- und Männergemeinschaften sind meist hierarchisch organisiert, und alles geht darum, wer besser, stärker, weiter oben ist. Diese Form, miteinander sozial umzugehen, verträgt sich nicht mit einer Offenheit über das, was man nicht kann. Man zeigt sich mit seinen Fertigkeiten, um nach oben zu kommen.
Das Bemühen, in der Männerordnung möglichst weit nach oben zu kommen
Es ist ja auch nicht so, dass Jungen wenig reden, die ziehen unheimlich viele Sprüche. Es ist ein richtiges Ranking, wer den coolsten Spruch macht. Aber das ist nicht ein Gespräch, sondern das Bemühen, in der Männerordnung möglichst weit nach oben zu kommen.
C. P.: Haben Mädchen auch eine Rangordnung? Wer die meisten SMS bekommt?
U. Meier: Da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich denke, dass es nicht nach der Menge der SMS geht, sondern um den Vorsprung in sozialer Geschicklichkeit. Ist ein Mädchen in der Lage, ein soziales Gelände ganz zu überblicken, z. B. eine Schulklasse, oder in Freundschaftsbeziehungen und Gruppen integriert zu sein? Natürlich gibt es auch unter Mädchen und Frauen Konkurrenzverhalten, und da ist das der Männer manchmal sogar noch angenehmer, wenn es bekannt und deutlich definiert ist.
C. P.: Um noch mal auf die Angst zurückzukommen: Sie sagten, dass ein Motiv dafür ist, sich in der eigenen Unvollkommenheit zu zeigen; kommt noch mehr dazu?
Gewalt als Angstabwehr
U. Meier: Es steckt noch mehr dahinter, was man aber selbst als Mann nur tastend suchen und benennen kann. Mathias Wais sagte einmal, dass er Männlichkeit für die fragilere Existenzform hält: Man ist sich seiner Existenz permanent nicht sicher. Mir selbst wurde dieser Zusammenhang schlagartig klar, als ich einmal zu einem Jungen sagte: „Warum hast du jetzt deinen Schulkameraden geschlagen?“ Die Antwort: „Der wollte mir was tun.“ Die Motivation zuzuschlagen war, dass der andere zuschlagen könnte. So einfach ist die Gefühlslage: Gewalt als Angstabwehrversuch. Eine andere Geschichte, die ich im Jugendknast erlebt habe: Ein Sechzehnjähriger erzählte ganz stolz, er hätte jetzt eine Freundin, sie würden sich jetzt auch lieben, aber das hätte er erst lernen müssen. Sie hatte vorher zu ihm gesagt: „Ich liebe dich“, und er hatte nicht verstanden, was das heißt. Er war in einem gesellschaftlichen Umfeld aufgewachsen, in dem es diese Vokabel nicht gab. Er brachte den einen Satz, an dem ich aufgewacht bin: „Das war mir so peinlich, dass ich ihr am liebsten eine reingeschlagen hätte.“ Ich hätte mich nie gewagt zu sagen, dass die Scham und die Gewalt so ursächlich miteinander zusammenhängen. Die Situation hatte sich dann aufgelöst, weil sie ihm erklärt hatte, was sie damit meinte.
Den Jungen fehlt heute ein initiatisches Erlebnis als Übergang vom Kind zum Mann, bei dem konstruktiv mit Angst umgegangen wird. Die Mädchen haben durch ihre erste Monatsblutung eine Realität vor sich, dass sie jetzt Frau sind. Die Jungen können sich nicht durch irgendetwas vergewissern, dass sie jetzt ein Mann sind. Es gehört zur Identifikation dazu, dass man in einer gewissen Art und Weise – wenn man es von den alten Kulturen her beschreibt – , sich von der Herkunftswelt und dem Kindsein abschottet und das auch nicht regressiv als „Hotel Mama“ bis Mitte zwanzig noch aufsucht. In diesen alten Kulturen lernte man, in einer fremden Lebenswelt, Wüste oder Wildnis, autark zu sein und sich zu bewähren. In diesem Sinne ist Wohlstand eines der größten Hindernisse für das gesunde Heranwachsen der männlichen Identität. Man ist immer zu viel versorgt, man bräuchte aber einen gewissen Mangel, um sich auf gute Weise zu beweisen. Und daraus kann man dann Verantwortung übernehmen in einer Gemeinschaft von Erwachsenen, was in unseren Ausbildungszeiten bis in die dreißiger Jahre hinausgezögert wird.
Ich habe den Eindruck, die Mädchen haben eine größere Zielgerichtetheit, sich in die erwachsene Verantwortungsgesellschaft hineinzustellen.
„Nach der Scheidung habe ich überhaupt erst begriffen, was ich als Vater sein will“
C. P.: Welche Bedeutung messen sie der Tatsache zu, dass viele Mütter heute allein erziehend sind, die Väter mehr oder weniger oder auch gar nicht da sind?
U. Meier: Das ist ein sehr vielfältiges Feld geworden. Es gibt Väter, die mir gesagt haben: Nach der Scheidung habe ich überhaupt erst begriffen, was ich als Vater sein will; jetzt kann ich es zwar weniger gut im Alltag leben, aber ich will es umso mehr versuchen. Und die Beziehung zu den Kindern wurde besser.
Die Arbeitswelt ist immer noch der Hauptfluchtort
Dann gibt es dieses große Feld der flüchtenden Väter. Früher waren sie aus Wirtschaftswundergründen nicht da, heute wird es anders genannt, aber die Arbeitswelt ist immer noch der Hauptfluchtort. Ein Teil dieser Fluchtbewegung – ich will diese Männer gerne in Schutz nehmen, weil es keinen Sinn hat sie zu beschimpfen – hängt damit zusammen, dass den Vätern die Bilder fehlen, wie sie Väter sein wollen. Das alte Vaterbild, nämlich der Patriarch, der alles bestimmt und mit strenger Hand in der Familie regiert, den will heute niemand mehr haben. Es als Mann dann so zu versuchen, wie die Frauen es sich wünschen, gelingt auch nicht jedem. Was soll denn heute ein Vater sein? Früher hatte er den Weltkontakt zu vermitteln. Heute bekommt den Hauptkontakt zur Welt die ältere Generation über die jüngere vermittelt, zum Beispiel in der Handhabung des Computers. Das lernt man heute meist von seinen Söhnen. Die Arbeitswelt ist so weit differenziert und entfremdet, dass keine großartigen Begegnungen mehr stattfinden können. Wir haben als Väter nichts mehr zu vermitteln, wenn die Jungen aus dem Kinderalter herausgewachsen sind.
alleinerziehende Mütter machen unglaublich kompetent ihre Erziehungsarbeit
Die größte Not der allein erziehenden Mütter sehe ich darin, dass sie meinen „weil ich jetzt verstanden haben, dass die Jungen Identifikation mit ihrer eigenen Geschlechterrolle finden sollen, muss ich nun auch noch die Männerseite vertreten“. Das ist ein Trugschluss. Im Grunde muss die allein erziehende Mutter entlastet werden von diesem Teil der Erziehungsarbeit, den sie auch gar nicht leisten kann. Und darum geht es auch gar nicht. Ich finde, dass allein erziehende Mütter unglaublich kompetent ihre Arbeit machen, aber natürlich sehr oft die Hilfe nicht bekommen, die man sich gegenseitig geben kann, wenn man zu zweit erzieht. Natürlich ist es leichter, wenn ich eine Grenze setzte, und weiß, dass ich noch einen Erziehungspartner habe, der mich selbst spiegelt und dem Kind ein anderer Hintergrund sein kann, als wenn ich im Alltagspädagogischen Nahkampf alleine da stehe. Es hat keinen Sinn, die allein erziehenden Mütter und auch nicht die flüchtenden Väter verantwortlich zu machen, sondern man muss darüber nachdenken, was man an Einrichtungen schaffen kann, an Schulen, Ganztagsschulen, Freizeiteinrichtungen, die den Jungen für ihr Alltagsabenteuer Raum geben können.
C. P.: Wie kann man damit umgehen, wenn Jungen bis hin zur Aggression die Grenzen überschreiten?
U. Meier: Da gibt es eine einfache Antwort: indem man ihnen Verantwortung gibt. Das ist eine positiv gerichtete Art von Stärke und Aggression. Als Verantwortliche dürfen sie im guten Sinn König und auch Krieger (siehe dazu HINWEIS Februar) sein, ohne destruktiv zu werden.
Wenn man als Pädagoge eine Gruppe vor sich hat, gibt es darin immer Rollen. Und eine für den Pädagogen am schwierigsten zu handhabende Rolle ist der gruppeninterne Anführer. Wenn der sich gegen den Pädagogen wendet, hat man einen „schwierigen“ Jungen. Ich muss mich als Pädagoge mit diesem Anführer positiv verbinden, denn sonst wird er nicht nur alleine, sondern mit der ganzen Gruppe gegen mich angehen. Ich muss ihm einen Teil meiner Verantwortung übertragen, dann bekommt er einen Teil der Rolle, die er naturgemäß übernimmt, mit meiner Erlaubnis.
Ich erinnere mich an einen Jungen, der dabei war, mir in der Konfirmandengruppe das Leben schwer zu machen. Ich fragte ihn, ob er einigen Mädchen, die aus einer anderen Stadt kamen und sich nicht auskannten, den Weg zeigen und sie in die Gemeinde führen könnte. Das war wirksam: Er machte das, war darin „König“, kannte sich aus, konnte seine Kompetenzen zeigen und war von mir als Gruppenleiter in dieser sinnvollen Rolle bestätigt.
Hinter den meisten gewalttätigen Gebärden steckt eine große Angst
Wenn Jungen die Grenzen massiv überschreiten, muss man sich zunächst die Hintergründe dafür klar machen. Das ist eine komplexe erzieherische Herausforderung, weil man einerseits Verständnis für die Motivation dieser Übergriffe braucht. Das bekommt man am ehesten, indem man sich vergegenwärtigt, dass hinter den meisten gewalttätigen Gebärden eine große Angst steckt. Aggressives Verhalten ist kein Explosionsstoff, der sich da irgendwie Bahn bricht, sondern geschieht aus Angst. Auf der anderen Seite muss ich mich natürlich auf die Seite des Opfers stellen und die Tat absolut zurückweisen und dafür sorgen, dass sie abgestellt wird. Aber ich brauche das Verständnis, um wirklich zu helfen. Und das geht nur präventiv, indem ich den Jungen ermögliche, dass sie gar nicht so stark in die Angst hineinkommen und sich nur über diese Art der Angstabwehr behaupten können. Man muss für sie Räume schaffen, wo sie Aggressionen, die ja eine eigentlich nur eine fehlgeleitete Annäherung an die Welt sind, so erproben und erüben können, dass es sich in einem verantwortbaren Rahmen hält.
wieder natürliche Erlebnisräume an die Kinder heranbringen
C. P.: Wie kann das geschehen?
U. Meier: Die Jungen sollen lernen, z. B. im Sport zu ihrem Körper, ein gutes und freies Gefühl aufzubauen. Das kann in Wettkämpfen geschehen. Dort sind sie den Regeln eines Spiels unterworfen, die in sich sinnvoll sind. Es gibt z.B. bei „forju“ in Göttingen Fortbildungen zur Jungenarbeit, wo Boxkampf angeboten wird. Es ist eine Möglichkeit, dass das, was sich sonst in Straßenschlachten oder Gruppenkämpfen wild auslebt, in eine Form zu bringen, die erlaubt ist. Denn Verbote bringen in der Regel nichts.
Und alleine finden die Kinder nicht mehr zu solchen Aktivitäten. Wir haben früher als Kinder in den Wäldern gespielt und uns dort an den Bäumen ausgelassen. Das ist heute das Problem: In einem voll durchgeplanten und gleichzeitig durch die Medienwirklichkeit scheinbar grenzenlosen Alltag müssen wir künstlich – oder besser künstlerisch – natürliche Erlebnisräume wieder an die Kinder heranbringen. Mit dem eigenen Körper die Grenzen der unzivilisierten Natur erfahren und sich darin zurecht zu finden, ist ein wesentliches Moment der Jungenerziehung.
Ich empfinde es als unfair, dass sich unsere Gesellschaft über gewalttätige Jugendliche entsetzt, es aber andererseits bequem findet, dass Jugendliche vor dem Computerbildschirm ruhig gestellt sind. Ein Kabarettist lässt einen Jugendlichen auf die Frage, was er denn so mache, antworten: „Wenn‘s gut geht, nichts!“.
C. P.: Sie erwähnten die Initiationsriten der alten Völker. Gäbe es in unserer Kultur etwas Vergleichbares?
U. Meier: Ich denke, dass für unsere Jungen heute die ganz normale Begegnung mit Körper und Natur Natur ausreicht, denn man kann solche Riten nicht ohne weiteres in unserer Kultur kopieren.
initiatische Männerarbeit
In der initiatischen Männerarbeit wird aber auch Weitergehendes versucht. Der Bremer Männercoach Reinhold Hermann Schäfer etwa bietet Naturseminare an, bei denen jeder einzelne Mann vier Tage und Nächte in der Wildnis ohne Nahrung sich behauptet, in einem Waldgebiet Schwedens fernab von jeder Zivilisation oder in der Sinai-Wüste. Der nächste erreichbare Punkt ist einer der anderen Teilnehmer, aber der ist eine Stunde Fußweg entfernt. So einsam ist man dort. Und dann hat man innere Aufgaben in dieser Auseinandersetzung und an dem Erleben der Natur. Es ist ähnlich wie die „Vision Quest“ der Indianer, bei der man seine inneren Antworten sucht. Ich selbst habe bei einer eintägigen Medizinwanderung in einem stadtnahen Wald bereits erlebt, wie schwach man einerseits wird, weil man keine Nahrung zu sich nimmt. Andererseits entsteht ein Gefühl davon, dass man sich in die Natur eingeordnet erlebt und das verleiht innere Stärke. Eine scheinbar paradoxe Empfindung, die sich aber im Erlebnis erschließt: Meine Schwäche wird zur Stärke.
Bei Kindern und Jugendlichen sind Abenteuerferien und Erlebnispädagogik die Felder, wo so etwas beginnt. Ich würde das aber nicht als Ritual gestalten.
C. P.: Sie sprachen von der Grenzsetzung, die gerade Jungen brauchen. Auf diesem Gebiet sind Eltern heute verunsichert oder auch überfordert. Gerade nach einer Trennung kann man beobachten, dass Eltern ihren Kindern viel erlauben, in dem Glauben, dadurch eine gute Beziehung zu ihnen aufrecht zu erhalten.
U. Meier: Das erlebe ich auch, andererseits gehen Eltern heute sehr kompetent an die Erziehung heran. Mitunter sind sie verunsichert und suchen dann in der Literatur Hilfe. In dieser Verunsicherung liegt gerade spezifisch für Jungen ein Problem, weil für sie eine gewisse Klarheit sehr hilfreich ist. Ein Vater erzählte mir, dass er jede Woche mit seinem vierjährigen Sohn einen ganzen Tag für sich erlebt. Schon beim Frühstück sagt er: „Ich trinke Milch. Magst Du auch?“ Die Mutter hätte gesagt: „Magst du lieber Apfelsaft oder Tee oder Wasser mit oder ohne Sprudel oder Milch?“ Und so ging er mit seinem Jungen nicht um. Das kann man als hart ansehen, aber das Kind hat eine Orientierung. Wenn man die Kinder mit einem Überangebot konfrontiert oder sie ständig vor Entscheidungen stellt, überträgt man die Erwachsenenwelt auf die Kinder. Und das ist unter anderem auch eine Quelle für Aggressivität, wenn sich Kinder nicht an der klaren Ansage von Erwachsenen orientieren können.
Wir lernen, subjektiv zu erziehen
Ich glaube, dass gerade die schwierigen Jungen uns zu einer neuen pädagogischen Tugend verhelfen: Wir lernen, subjektiv zu erziehen. Das heißt, nicht das „Richtige“ machen zu wollen, was auf irgendeiner Tabelle in einem Erziehungsbuch steht: „Wenn der Sohn widerspricht, dann darf ich …. sagen“, sondern man lernt darauf zu achten: jetzt ist meine Grenze erreicht. Und die setze ich durch, denn es gibt keine objektiv richtigen Grenzen, sondern nur die, die ich vertrete.
Ich erlebe das immer wieder in der Diskussion um Spielzeugwaffen. Darauf gibt es keine Rezept-Antwort. Viele Männer in Männerseminaren geben zu, dass sie mit Pistolen gespielt haben. Aber an dieser Stelle gibt es ganz unterschiedliche Grenzen, und ich finde es völlig richtig, wenn jemand sagt: In meinem Haushalt gibt es das nicht. Wenn ein anderer meint, dass sein Sohn eine Spielzeugpistole haben soll, er diese Pistole mit ihm anschafft, erklärt, welche Grenzen es dabei gibt, ist das auch in Ordnung. Man kann nicht sagen, das eine ist richtig und das andere verkehrt.
Bei massiven Grenzüberschreitungen interessiert sich die Gesellschaft …
C. P.: Wie kann man sich verhalten, wenn es trotz aller Bemühungen zu massiven Ausschreitungen und zerstörerischen Handlungen von Jugendlichen kommt?
U. Meier: Für solche massiven Grenzüberschreitungen interessiert sich dann ja auch die Gesellschaft in Gestalt von Polizei und Staatsanwaltschaft. So sehr es wünschenswert wäre, dass sie schon bei der normalen Erziehungsarbeit echtes Interesse zeigt, die Mitwirkung bei der Grenzsetzung durch Polizei und Jugendgericht sollte meines Erachtens als Entlastung für die unmittelbar Erziehenden gesehen werden, nicht als Beschämung für mangelhaften Erziehungserfolg. Wenn Jugendliche dauerhaft und heftig die Grenzen ihrer Eltern missachten, erfahren sie auf diese Weise eine zwar bittere, aber trotzdem manchmal heilende Korrektur.
aus der Wohlstandsversorgung herauskommen
C. P.: Sie sagten, dass sich die Gesellschaft mehr um die Jugendlichen kümmern sollte. Wie könnte das aussehen?
U. Meier: Ich bin ein Freund der Ganztagsschulen mit ihrer Aufgabe, Freizeitangebote zu machen. In der schulischen Freizeitpädagogik, nicht im Urlaub, könnte wieder ein Bereich entstehen für das „Abenteuer im Alltag“. Dort könnten Jugendliche lernen, selbstverantwortlich zu handeln, z. B. wie in den Wanderprojekten einzelner Waldorfschulen, in denen ältere Jugendliche mit jüngeren Wochenendwanderungen machen im nahe gelegenen Stadtwald. In den Ferien geht es dann in wenig zivilisiertes Gelände, wo man mit Landkarte gerade noch den Weg findet, zu wenig Proviant mitgenommen hat usw.. Sie müssen Gelegenheiten haben, aus der Wohlstandsversorgung herauszukommen, und zwar auch außerhalb des Elternhauses und in Selbstorganisation.
C. P.: Wie findet man als erwachsener Mann zu den von Ihnen geschilderten männlichen Urbildern des Königs, Kriegers, Magiers und Liebhabers (siehe HINWEIS Februar)?
U. Meier: Der Nationalsozialismus hat durch seine totale Überzeichnung der männlichen Urbilder einen großen Schaden angerichtet. Da sind wir noch in einer Gegenbewegung, und es ist nicht einfach, da wieder herauszufinden.
Wenn man nun aber diese vier Bilder als eine Möglichkeit anerkennt, kann man sich zunächst fragen, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen. Hat man mehr Stärken als Liebhaber, hat man Königsqualitäten usw.? Soweit ich das einschätze, liegen für die heutigen Männer die Schwächen mehr beim König und beim Krieger. Als zweiten Schritt kann man dann forschen, was man für sich tun kann. Beispielsweise besteht die Königsqualität darin, dass man deshalb eine Autorität ist, weil man sich selbst bestimmt. Man kann sich fragen, ob man für sich genügend selbstständig ist oder andere Leute braucht, z. B. die Partnerin, um die Selbständigkeit überhaupt herzustellen.
Beim Liebhaber ist die Schattenseite der Süchtige. Sucht heißt, keine Distanz zu haben. Der Süchtige „zieht“ sich die Welt, die er als Gegenüber gar nicht begegnen kann, dann im Übermaß rein, und dann entfaltet sie ihr Gift. Als Liebhaber hat man Souveränität, man ist auch zur Distanz und nicht nur zur Nähe fähig. Der Süchtige braucht die Partnerin, und wenn sie ihn verlässt, sucht er sich gleich die Nächste.
König in der Beziehung sein heißt auch, partnerschaftsfähig zu sein. Wenn man in die Schattenseite abgleitet, hat man den inneren Zwang zu beherrschen und/oder abhängig zu bleiben, und dann instrumentalisiert man die Partnerin als Untergebene bzw. Mutter.
Der Magier kann mit Bildern umgehen, er hat künstlerische Fähigkeiten. Er hat Zugang zur Welt, die sich hinter der Oberfläche verbirgt. Der Schatten des Manipulators entfaltet sich da, wo ich zu schwach bin, die Bilder für sich sprechen zu lassen und mit ihnen das durchsetzen will, was ich anders nicht hinbekomme.
Der Krieger hat ein verantwortliches Verhältnis zum Tod. Er setzt Ende und Neubeginn als Gebärde des Sozialen fruchtbar ein. Der Killer hat – das ergibt sich aus dem Nachdenken über jugendliche Gewalttäter – hat Angst vor dem Sterben. In vielen Sprachen ist der Tod weiblich…
C. P.: Diese vier Urbilder können also Richtlinien für eine männliche Entwicklung geben?
U. Meier: Man kann es auch ganz global sagen: Männliche Identitäten finden bedeutet auch, sich mit den weiblichen Teilen von sich selbst zu beschäftigen und diese nicht von außen zu ergänzen. Man könnte fast sagen, dass man als Mann den weiblichen Teil in sich braucht, um die Männlichkeit ins Gleichgewicht zu bringen. Ich spreche auch deshalb von männlichen Identitäten im Plural, weil nicht eine für alle passt, sondern es ist immer Patchwork.
die neuen Männergruppen
C. P.: Was kann man als Mann machen, bzw. welche Hilfe kann man sich holen, um diese Identitäten zu finden?
U. Meier: Am besten sind dafür neue Männergruppen geeignet, die jetzt immer mehr entstehen. Sie haben eine andere Qualität als in den achtziger Jahren, weil sie nicht eine trotzige Nachahmung der Frauengruppen sind. Um es bildhaft auszudrücken: Sie sind die Gebärmutter für den einzelnen Mann. Der kann sich in dem Spiegel der anderen finden. Man hat einen Schonraum, um bestimmte Dinge besprechen zu können, zum Beispiel Berufsprobleme. Das kann man sonst nur unzureichend in der Partnerschaft besprechen oder oberflächlich irgendwo am Kneipentresen. Aber sich unter Männern klarzumachen, in welchem Verhältnis man zu seiner Arbeitsbiografie steht, gelingt gerade dort in besonderem Maße, weil man nicht Kollege oder Partner ist.
Ein anderer Weg ist die Ausübung von Kunst, d. h. dass man die Ausdrucksmöglichkeit des Künstlerischen für sich entdeckt. Damit entwickelt man gleichzeitig auch das Urbild des Magiers in sich. Beispielsweise biete ich Gruppen mit „Theatersport“ an. Es fällt Jungens leichter, dort einzusteigen, als in andere Theaterprojekte – möglicherweise, weil es „Sport“ heißt. Die Entdeckung der Phantasie ist auch eine Erfahrung gegen die Angst. Das „kindliche Denken“ (Theatersportgründer Keith Johnstone) hat auch für die auswegloseste Situation eine gute Lösung.
C. P.: Was kann man als Frau tun, um konstruktiv diese Entwicklungsprozesse zu unterstützen?
U. Meier: Man hilft den Männern am wenigsten durch Bemuttern oder Jammern über das, was nicht passiert. In einer reinen Frauenrunde zum Thema Jungenpädagogik wurde über die rückständigen Männer gestöhnt. Ich habe diese Klagerunde unterbrochen mit der Frage: „Sagen Sie das auch Ihren Männern?“ Und sie haben geantwortet: „Das nützt ja sowieso nichts.“ Jammern unter Gleichgesinnten nützt meistens nichts. Ich halte es für sinnvoll, dass man die emotionale Versorgungsleitung kappt, d. h. dass man mit dem Klagen darüber aufhört, dass die Männer nicht in Bewegung und Entwicklung kommen, dass sie nichts tun usw., sondern sagt: „Jetzt reicht es mir!“ Bezeichnenderweise werden 70% der Ehescheidungen von Frauen initiiert, und es ist gesund, dass sie es dann irgendwann einmal machen. Aber vielleicht können sie ihre Grenze eher, und zwar innerhalb der Beziehung deutlich machen. Es wäre eine abgrenzende Gebärde, aus der Symbiose- und Abhängigkeitsbeziehung auszusteigen und nicht immer alles für das Wohlergehen des Mannes zu tun. „Ich möchte meine Sachen machen und erwarte von dir, dass du deine Sachen machst.“
Dazu gehört unbedingt, dass die Frauen den Männern zugestehen, dass sie ganz eigene Bereiche entwickeln. Wenn man die Männer fragt, was für sie der wichtigste Lebensbereich ist, schwanken sie zwischen Beruf und Familie, und keiner sagt: „Mein eigener Lebensbereich ist mir der wichtigste. Nur wenn ich mich um diesen Bereich genug sorge, kann ich auch in der Familie und im Beruf existieren.“ Normalerweise schaltet man von einem zum anderen Bereich um und hat immer ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, es gibt bei den Männern auch eine neue Bereitschaft, sich diesen eigenen Bereich aufzubauen.
C. P.: Sie sprachen davon, dass die Frauen die „emotionale Versorgungsleitung kappen“ sollen. Wie kann man das als Frau authentisch und für beide förderlich machen?
„emotionalen Selbstversorgung“
U. Meier: Ich finde dabei den Begriff der „emotionalen Selbstversorgung“ zentral. Als Frau sollte man sich nicht verantwortlich fühlen für den Gefühlshaushalt des Partners. „Ich kümmere mich nicht darum, dass es dir gut geht und dass du gut leben kannst.“ Sondern: „Du musst wissen, ob du zu viel arbeitest, ob du genug für deine Gesundheit tust, was du brauchst, damit es dir gut geht. Du musst selbst wissen, wie du mit Schmerzen und Verletzungen umgehst.“ Dieses ganze Feld von wohlmeinenden Ratschlägen und die Versorgung einfach bleiben lassen.
C. P.: Dann würden einige Männer aber weiter machen bis zu einem gesundheitlichen Zusammenbruch …?
U. Meier: Genau. Man kann dabei aber mit kleinen alltäglichen Schritten anfangen und sich als Frau genau beobachten, wie oft man sich in der letzten Woche in den Gefühlshaushalt des Mannes eingemischt hat, ihm Vorschläge oder Vorhaltungen gemacht hat, Beobachtungen mitgeteilt hat, die eigentlich seine eigene Angelegenheit sind. Frauen beobachten mit ausgefahrenen Antennen: „Wie kommt er heute nach Hause, und was muss ich tun, damit der Abend einigermaßen harmonisch wird?“ Das aufzuhören hat nichts mit Lieblosigkeit zu tun, sondern mit einer eigenständigen Lebensführung, die erst eine wirkliche Partnerschaft ermöglicht.
Fatalerweise wirkt die unreife Mädchenpädagogik noch so nach, dass sich Frauen immer verantwortlich fühlen für den anderen. Bis dahin, dass der inzwischen verstorbene Papst gesagt hat: „Die Frau ist von Natur aus auf den anderen bezogen.“
C. P.: Aber wie kann man als Frau solche Schritte ankündigen, damit die Männer sie dann nicht als mangelnde Liebe interpretieren?
U. Meier: Das ist nicht nur eine Frage der geeigneten Kommunikation, sondern der Haltung. Suche ich nach einer Entlastung für meine Situation als Frau oder will ich meinen Partner erziehen? Der Schlüssel der „emotionalen Selbstversorgung“ dient auch dazu, dass ich in der Kommunikation „bei mir bleiben“ kann und mich nicht gegen den anderen wenden muss.
C. P.: Außer in der Bestimmung der Grenzen …
U. Meier: … wie in der Jungenpädagogik, genau.
Ulrich Meier gibt ein Seminar auf dem 7. MännerLeben Kongress, 10. März 2007 in Stuttgart. Details sind zu finden unter www.maennerleben.com. Das Programm kann kostenlos angefordert werden im Gesundheitspflege-Büro, Paracelsusstr. 33, 73730 Esslingen, Tel. 0711. 316 81 81, Fax 0711.931 97 70
Vortrag am 20. April im Rudolf Steiner Haus, veranstaltet von ZeitZeichen: „Männer holt auf!“
Literatur: Mathias Wais/Ulrich Meier: *Projekt Mann. Was ist Männlichkeit – und wenn ja, warum nicht?** Verlag Johannes *Mayer, Stuttgart, 2002
Ulrich Meier: *Männerwerkstatt. Nachdenken über das starke Geschlecht, **Verlag* Urachhaus, 2005