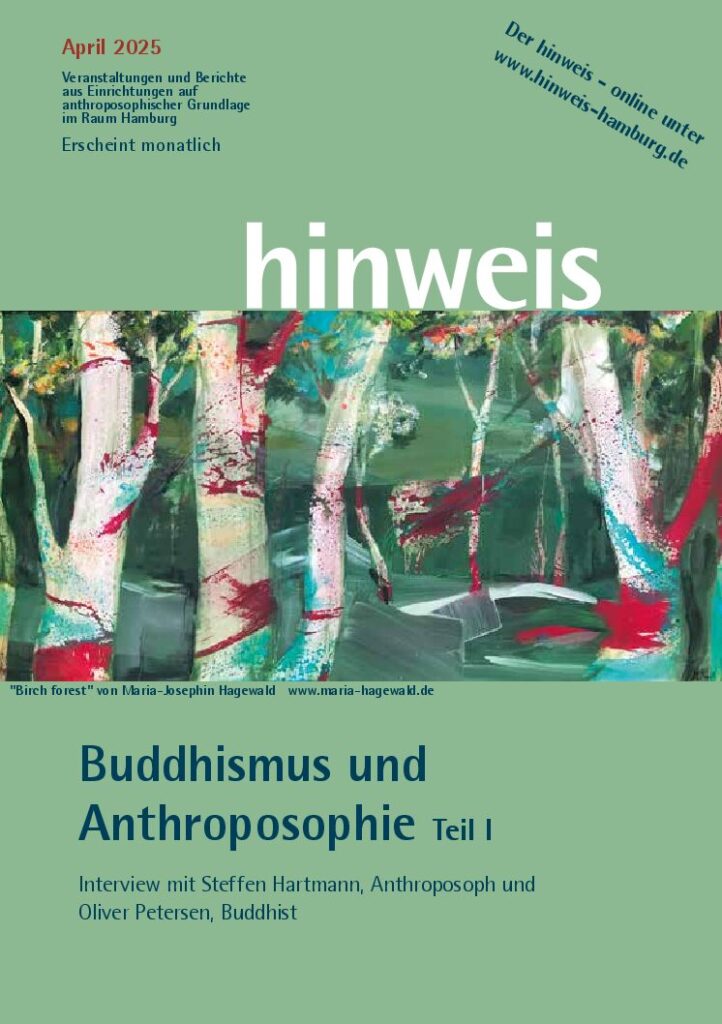Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
Leben mit Autismus
Interview mit Jos Meereboer, Dozent für Heilpädagogik

Als merkwürdige Einzelgänger, teilweise hochintelligent und im sozialen Kontakt schwer zugänglich – so stellen wir uns im Allgemeinen Autisten vor.
Was erleben Autisten aber wirklich? Woher kommt ihre Angst im Sozialen? Was bedeutet es, in dem eigenen Leib nicht wirklich „drin zu sein“ und den eigenen Willen nicht ergreifen zu können, andererseits aber alles wahrzunehmen, was andere Menschen denken? Und was hat der Autismus mit unserer heutigen Informationsgesellschaft zu tun?
Interviewpartner: Jos Meereboer, geb. 1948 in Schoorl, Holland. Ausbildung als Graphiker und Heilpädagoge. Seit 1979 in Deutschland tätig als heilpädagogischer Lehrer und Dozent in verschiedenen Einrichtungen, in Hamburg u. a. im Lehrerseminar und in der Kunstakademie Brehmweg. Jos Meereboer hielt am 11. Januar in der Rudolf Steiner Buchhandlung einen Vortrag „Draußen vor der Tür. Autismus – Leben in zwei Welten“.
Christine Pflug: Autismus wurde 1943/44 diagnostiziert von Kanner und Asperger. Leo Kanner beschrieb den ganz schweren Autismus und Asperger die leichtere Form. Menschen mit dem Asperger-Syndrom können gelegentlich hochintelligent sein, was 1988 durch den Film „Rain Man“ in der breiten Masse populär wurde. Wie würdest Du die Unterschiede charakterisieren?
Jos Meereboer: Menschen mit schwerem Autismus machen nichts: Sie sitzen in der Ecke und reden kaum. Sie bekommen alles mit, haben aber keinen Zugang zu ihrem eigenen Willensleben – sie „können nicht wollen“. Menschen mit Asperger-Syndrom haben teilweise Zugriff auf ihr Willensleben, können arbeiten, sogar Hochschulabschlüsse machen.
C. P.: Einige Krankheiten besagen etwas über die Zeitsituation, in der sie entstehen. Das sog. Down-Syndrom ist entstanden zum Beginn der Industrialisierung in England, und die Menschen mit Down-Syndrom stehen im Gegensatz zu dieser leistungsorientierten Gesellschaft …
J. Meereboer: Konkurrenz und Wettbewerbsstress ist ihnen einfach fremd. Sie unterteilen die Menschen nicht in antipathisch oder sympathisch, sondern nehmen alle gerne in den Arm. Sie strahlen etwas Liebevolles und Warmes aus, wogegen die Industrialisierung die Menschen in ihrem Herzen eher kalt macht.
wenn man hinter dem Bildschirm sitzt, macht man das Gleiche wie ein Autist
C. P.:Was sagt dann der Autismus über unsere heutige Zeit aus?
J. Meereboer: Kanner und Asperger haben diese Symptomatik das erste Mal beschrieben, aber ich glaube, dass es Autismus schon länger gibt und die Autisten früher einfach als schwerstbehindert eingestuft wurden.
Meiner Meinung nach nehmen sie quasi vorweg, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt. Wir hatten zuerst eine landwirtschaftliche, dann eine industrialisierte Gesellschaft, und jetzt leben wir in der Informationsgesellschaft. Und diese Informationsgesellschaft macht die Menschen zu Autisten: Wenn man hinter dem Bildschirm sitzt, macht man das Gleiche wie ein Autist, der mit seinem ganzen Wesen, statt in seinem Leib zu sein, quasi in dem Staubsauger oder Ventilator sitzt. Man hat dann keinen Kontakt mit der Außenwelt und den Mitmenschen. Davor hat Rudolf Steiner 1924 im Heilpädagogischen Kurs gewarnt: Wenn wir kein Interesse für unsere irdische Außenwelt entwickeln, sind wir nicht im Stande, zwischen Tod und einer neuen Geburt unsere nächste Inkarnation vorzubereiten. Das gilt auch, wenn die Menschen irgendeines Zeitalters vom Morgen bis zum Abend in Räumen eingesperrt werden. (So sinngemäß im ersten Vortrag dieses Kurses).
Es ist allerdings ein Unterschied, ob man sich durch zu viel Beschäftigung mit dem Computer zu einem Autisten gemacht hat, oder ob man als einer geboren ist. Autisten werden im nächsten Leben eine gesunde Inkarnation durchmachen, ihr „Sosein“ hat mit ihrem letzten Leben zu tun. (Siehe dazu Flensburger Hefte 112)
sie haben einen Bezug zur Technik und zu Dingen, also zu dem, was tot ist
C. P.: Wie kann man sich das vorstellen, wenn die Autisten sich mit ihrer Aufmerksamkeit auf diese „Dingwelt“, wie z. B. Waschmaschinen, Türklinken, Ventilatoren etc. fokussieren?
J. Meereboer: Man kann nicht sagen, dass sie für das eine Interesse haben und für das andere nicht, sondern es fehlt ihnen der Bezug zu dem, was lebendig und vital ist, z. B. zu Pflanzen, Tieren und Menschen. Und wenn sie einen Bezug dazu haben, dann behandeln sie dieses Lebendige eher als ein Ding. Die schweren Autisten haben zur gar nichts eine Verbindung, und auch in ihrem Verhalten und in ihrem Tagesablauf sind sie wie automatisiert. Die Beziehung zu ihrem Leib ist so, dass sie sich quasi von ihm abwenden, denn der Körper ist ja auch etwas Lebendiges. Stattdessen haben sie einen Bezug zur Technik und zu Dingen, also zu dem, was tot ist. Das einzige, zu dem sie in ihrem Leib eine Verbindung haben, ist das Gehirn als das am wenigsten vitale Körperteil; aber weil sie auf diese Art auf das Gehirn fixiert sind, sind sie nicht in der Lage, es richtig zu nutzen; denn eigentlich sollen wir vergessen, dass wir ein Gehirn haben, damit es ein Spiegelapparat unserer Wahrnehmung sein kann. Wenn wir in den Spiegel schauen, fixieren wir uns auch nicht auf das Glas, sondern auf unser Spiegelbild. Wenn wir Sinneseindrücke haben, bekommen wir in unserem Gehirn Vorstellungen d. h. innere Abbildungen von diesen Eindrücken. Die Menschen mit schwerem Autismus sehen das Gehirn als ein Ding an, z. B. wie einen Staubsauger.
alles muss eine ganz feste Ordnung haben
Wir benutzen unsere Gehirnfunktionen, um Vorstellungen zu bilden und in unserem Innenleben Ordnung zu schaffen, und sie setzen es aus sich heraus, wollen quasi im Äußeren die Ordnung herstellen. Daraus entstehen Zwänge, beispielsweise haben sie Symmetriezwänge: Wenn eine Schublade herausgezogen ist, dann müssen alle anderen Schubladen auch herausgezogen sein; wenn beim Mittagessen auf den Teller das Essen gefüllt wird, laufen sie schnell zum Schrank und stellen andere Teller dazu, damit wieder eine Symmetrie hergestellt ist. Ihre Vorstellungswelt ist außen um sie herum, und alles muss eine ganz feste Ordnung haben, so wie wir in unserem Vorstellungsleben auch nichts durcheinander bringen dürfen.
leben in zwei Welten
C. P.: Und was passiert, wenn sie diese Sicherheit nicht antreffen oder herstellen können?
J. Meereboer: Dann bekommen sie Angst und fangen an zu schreien, weil sie seelisch Schmerz erleben. Diese äußere Ordnung, die wir durch unsere Vorstellungswelt haben, ist für sie die Orientierung auf der Welt.
Die schweren Autisten leben in zwei Welten, zum einen im Vorgeburtlichen, weil sie den Schritt auf die Erde nicht richtig vollzogen haben, aber zum anderen sind sie mit ihrem Leib nun mal auf der Erde. Sie wissen oft nicht, ob sie in der vorgeburtlich-geistigen Welt sind oder auf der Erde. Das bekommen sie durcheinander, was zur Folge hat, dass sie eine eingeschränkte Orientierung in Raum und Zeit haben. Wir haben in unserer Kindheit uns so entwickelt, dass wir die beiden Welten voneinander trennen.
C. P.: Woran merkt man, dass sie im Vorgeburtlichen leben?
J. Meereboer: Man kann es vergleichen mit kleinen Kindern, die noch nicht richtig „ich“ sagen können. Sie sind auch noch nicht völlig auf der Erde angekommen, d. h. sind noch so eins mit der Außenwelt, dass sie das von ihrer Innenwelt nicht unterscheiden können. Eine eigene Innenwelt bildet das Kind erst, wenn das Kind „ich“ zu sich sagt und durch den Leib die Erde und Außenwelt wahrnimmt.
In dieser früheren Phase nehmen die Kinder das auf, was die Menschen denken und nicht das, was sie sagen. Wenn die Eltern denken: „Kind, du bist zu früh geboren, weil wir die Firma noch nicht gegründet haben“, nimmt das Kind das wahr und u. U. wächst es mit einem Schuldgefühl auf, weil es die Eltern in ihrem Vorhaben gestört hat. So ist das auch bei den Autisten: Sie nehmen alles wahr, was andere Menschen denken.
C. P.: Kannst Du das aus Deiner Erfahrung so bestätigen?
J. Meereboer: Ich habe dazu einige Beispiele erlebt. Ein Autist wohnte in einem Heim und 100 km entfernt unterhielten sich die Eltern: „Morgen holen wir Peter ab“. Das brauchte man ihm dann nicht mehr zu sagen – er wusste es selbst. Ein anderer Autist aus Schweden saß in einem deutschen Theaterstück, aber er brauchte die Sprache nicht zu verstehen, weil er wusste, was die Schauspieler denken.
C. P.: Man kann diesen Menschen durch „gestützte Kommunikation“ helfen. Wie wird das gemacht?
gestützte Kommunikation
J. Meereboer: Wenn ein Autist keinen Zugriff auf sein Willensleben hat und dadurch nicht sprechen und nicht schreiben kann, ist er auf das Willensleben seiner Mitmenschen angewiesen. Es gibt dazu die technischen Möglichkeiten mit einer Lesemaschine, einem Computer oder simpel mit einem Stift: Der Therapeut sitzt neben dem Autisten, stellt quasi seine Willenskraft zur Verfügung und denkt selbst an nichts; er hält den Arm des Autisten ein wenig fest, und dieser ist dann in der Lage zu schreiben. Dadurch ist er fähig, seine Gedanken auf Papier zu bringen. Der Therapeut darf selbst nichts denken, sonst schreibt der Autist eventuell die Gedanken des Therapeuten auf oder er wird wütend, weil es ihm nicht gelingt etwas zu schreiben.
Ein Beispiel aus einem Camphilldorf: Ein Schüler mit 16 Jahren, der zum ersten Mal gestützte Kommunikation gemacht hat und sich dann äußern konnte, schrieb als erstes: Er wollte seiner früheren Lehrerin sehr danken; er war immer in der Klasse dabei, und obwohl er nur passiv in der Ecke saß und nichts tat, hatte er viel von ihr gelernt. Man denkt, wenn sie in der Ecke sitzen, bekommen sie nichts mit. Aber das ist nicht so – sie kriegen alles mit! Wenn wir das auch lernen würden, wahrzunehmen, was andere denken, bräuchten wir keine Handys mehr.
Gestützte Kommunikation ist für diejenigen Autisten, die nicht sprechen können. Meistens ist bei solchen Autisten der Sprachorganismus in Ordnung. Sie sind aber nicht in der Lage diese Fähigkeit einzusetzen, weil sie keinen Zugriff auf ihren Willen haben.
man darf von ihnen nichts erwarten
C. P.: Die Menschen mit der schweren Form von Autismus leben in gewisser Hinsicht in einer eigenen Welt. Kann man davon ausgehen, dass Menschen mit der leichteren Form von Autismus sozusagen mitten unter uns sind, im normalen Arbeitsleben stehen etc.?
J. Meereboer: Da gibt es wieder fließende Übergänge. Man erkennt Autisten daran, dass sie Angst im Sozialen haben oder nicht in sozialen Bezügen leben, also Einzelgänger sind. Sie wirken vielleicht verschroben, haben einseitige Begabungen, die eventuell herausragend sein können. In Gesprächen äußern sie sich so, dass der Inhalt Sinn hat, aber nicht im richtigen Moment ausgesprochen wird. Diese Menschen kann man nicht eigentlich als Autisten bezeichnen, sondern sie haben autistische Symptome. Wenn es mehr in die Richtung Autismus geht, kommen andere Ängste und zwanghaftes Verhalten dazu. In den heilpädagogischen Schulen haben solche Kinder oftmals hübsche Gesichter, wirken körperlich nicht behindert, aber es dauert sehr lange, bis sie Vertrauen finden. Ich hatte ein Mädchen in der Klasse, und es dauerte ein Jahr, bis sie ihre Angst überwunden hatte. Am ersten Schultag wollte sie nichts machen, sie saß unterm Tisch und spielte Tiger, um alle Anforderungen von sich fern zu halten. Das ist auch typisch: Man darf von ihnen nichts erwarten. Ich kam dann auf die Idee, ein Mädchen mit Down-Syndrom zu ihr zu schicken. Sie erwartete nichts von ihr, sondern hat sie einfach zum Mitmachen eingeladen – das können die Menschen mit Down-Syndrom sehr gut.
eigentlich sind sie sehr empfindlich und bauen einen Panzer um sich
C. P.: Mit was überspielen die erwachsenen Autisten ihre Angst im Sozialen?
J. Meereboer: Mit Distanz, Arroganz, Überheblichkeit, unverbindlichen Floskeln. Eigentlich sind sie sehr empfindlich und bauen einen Panzer um sich. Das ist aber nur eine Spielart von vielen Möglichkeiten der autistischen Verhaltensweisen. Man muss herausschälen, was allgemein gilt und das ist beispielsweise die fehlende Wärme in der Begegnung.
sie können ihre Zuneigung nicht zeigen
C. P.: Finden sie keine Beziehung zu anderen Menschen?
J. Meereboer: Bei den Kindern ist es oft so, dass sie die Mutter wie ein Ding behandeln. Die Mutter fühlt sich ihrem eigenen Kind gegenüber wie ein Gebrauchsgegenstand und fühlt sich nicht von ihm geliebt. Auf übergeordneter Ebene sind sie tief verbunden mit ihrer Mutter, aber sie können es seelisch nicht zum Ausdruck bringen und können ihre Zuneigung nicht zeigen.
C. P.: Das, was Du von den Menschen mit Down-Syndrom beschreibst: jemanden einladen, ohne etwas von ihm zu erwarten – das ist ja auch ein soziales Kunststück!
nicht gegen den eigenen Willen Therapie verordnen
J. Meereboer: Etwas umsetzten, was ein anderer von ihnen erwartet, das können Autisten nicht – sie müssen ihr „eigenes Ding machen“. Wenn man sie aber einlädt und nichts von ihnen erwartet, so wie das die Down-Menschen gut können, fühlen sie sich nicht gezwungen.
Ich habe einmal eine Situation mit einem Autisten erlebt, der in einer Gruppe nur zum Essen kam, wenn alle anderen wieder weg waren. Ich hatte den Leitern dann vorgeschlagen, dass sie in die Gruppe einen Menschen mit Down-Syndrom aufnehmen sollen – und ab dann kam er immer zum Mittagessen.
Das A und O ist, dass man akzeptiert, dass ein Mensch autistisch ist und ihm nicht gegen den eigenen Willen Therapie verordnet. Wenn man dazu noch positiv über ihn denkt, nimmt er das auch wahr und entwickelt Vertrauen. Wenn man dagegen denkt „du bist behindert“, merkt er das auch und will mit einem nichts zu tun haben.
Und das Besondere an den Menschen mit Down-Syndrom ist, dass sie keine Urteile haben, sie nehmen einen so, wie man ist. Das können wir von ihnen lernen.
C. P.: Wissen Autisten, was Gefühle sind?
J. Meereboer: Ihr Umgang damit ist nicht unbedingt seelisch, sondern geistig. Sie haben eine geistige Überschau von der Situation, in der sie sich befinden, und aus dieser Sicht merken sie, welche Menschen traurig, fröhlich sind, oder wer negativ oder positiv gestimmt ist. Sie nehmen das wahr, fast objektiv, aber es berührt sie nicht selber emotional. Sie haben keine seelische Empathie, sondern eine geistige Schau. Sie können anknüpfen an Erfahrungen, die sie in vorigen Erdenleben gemacht haben, aber nicht an das, was sie in diesem Leben erfahren haben. Wir beurteilen Trauer nach unserer subjektiven Trauer, sie aber nehmen die Trauer als solche wahr.
Wenn wir einem Menschen begegnen, machen wir das in gewisser Hinsicht mit unserem Leib. Wir blicken jemandem in die Augen oder geben ihm die Hand, und dann haben wir einen Ich-Kontakt. Bei Autisten ist das mehr oder weniger nicht möglich – sie können keinen Blickkontakt mit anderen Menschen herstellen. Man hat das Gefühl, dass sie einen nicht wahrnehmen in der eigenen Traurigkeit, Fröhlichkeit oder in anderen Gefühlen. Ihre Art der Begegnung ist dann jenseits des Leibes, in dem sie nicht richtig inkarniert sind, und es hat auf eine Weise etwas Objektives.
Ich habe einmal einen Brief von einem Autist bekommen: Er redet von sich, redet auch über mich, weiß genau wo ich bin und was ich mache, aber der Brief ist total übergeordnet und unpersönlich.
C. P.: Sie nehmen übergeordnet etwas wahr, können es aber nicht in die Begegnung reinbringen. Der Körper ist gesund, alles ist als Potential vorhanden, kann aber nicht ergriffen werden. Sie können dem, was in ihnen lebt, nie einen Ausdruck verleihen und können nie etwas nach außen setzen, d. h. sich von etwas distanzieren, es bearbeiten und sich befreien. Wenn man sich in diese Lage hineinversetzt: Es ist ja kaum zum aushalten!
sie fühlen sich verlassen und unverstanden
J. Meereboer: Genau – es sind diejenigen Menschen „mit besonderem Hilfebedarf“, (das ist ein besserer Ausdruck als „Behinderte“), die mit ihrem Schicksal unglücklich sind. Sie fühlen sich verlassen und unverstanden. Deshalb ist die gestützte Kommunikation für sie eine Wohltat: Sie können sich plötzlich äußern.
Die Menschen mit Down-Syndrom dagegen sind die glücklichsten. Alle anderen pendeln dazwischen.
C. P.: Können sie selbst etwas tun, um aus dieser Isolation herauszukommen?
J. Meereboer: Die schweren Autisten können gar nichts tun, sie sind auf die Hilfe und das Verständnis ihrer Mitmenschen angewiesen. Diejenigen mit einem leichteren Autismus können im Erwachsenenalter eine sinnvolle Aufgabe bekommen, dann fühlen sie sich wenigstens als Erdenbürger. Sie könnten mitunter studieren, Gedichte schreiben oder anderes, sind aber wieder angewiesen auf das Umfeld, das ihnen das ermöglicht.
Wenn sie in ihrer Eigenartigkeit abgelehnt werden, fallen sie in ihrer Entwicklung sofort zurück. Wenn sie aber bei ihren Mitmenschen Verständnis und Toleranz erfahren, können sie damit einigermaßen leben.