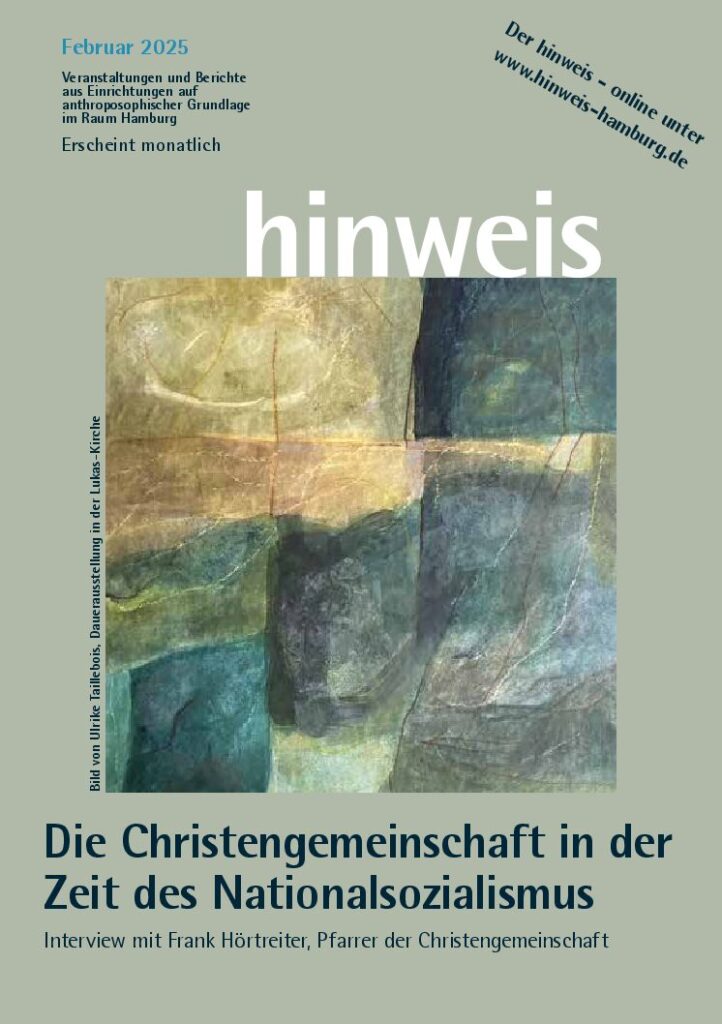Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
Soziale Dreigliederung im persönlichen Leben
Interview mit Lars Grünewald, Kulturwissenschaftler

Soziale Dreigliederung – man könnte sie als das politische Konzept von Rudolf Steiner bezeichnen. Aber mitunter ist es so, dass Politik irgendwie „die Anderen“ und äußere Umstände sind. So stellt sich die Frage: Was kann man selbst machen, die Prinzipien der Sozialen Dreigliederung täglich im persönlichen Leben umzusetzen? Welche Fähigkeiten gilt es dafür zu entwickeln? Und letztlich geht es darum, wie man dadurch eine Grundlage für politische Veränderungen schaffen kann.
Interviewpartner: Lars Grünewald, geb. 1962, Studium der Musikwissenschaften und Erziehungswissenschaften, danach privates Philosophiestudium. Seminare und Vorträge zu philosophischen und sozialwissenschaftlichen Themen. Außerdem Tätigkeit in schulischen Zusammenhängen (Unterricht, Lehrerbildung, Schulberatung). Website: www.selbstorganisierte-bildung.de
Christine Pflug: In der Juni-Ausgabe des hinweis war ein interessanter Bericht von der Tagung für Soziale Dreigliederung anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens: „ImPuls für die Zukunft“. Es wurden verschiedene wirtschaftliche und soziale Projekte beschrieben, in denen soziale Dreigliederung mehr oder weniger erfolgreich praktiziert wird. Soziale Dreigliederung wird als ein politisch-gesellschaftliches Modell verstanden. Das birgt die Gefahr, dass man im Äußeren etwas herbeiführen möchte, wofür man aber selbst gar nicht die Fähigkeiten dazu hat.
Insofern die Frage: Wie und wo kann jeder im privaten und persönlichen Umfeld und bei sich selbst beginnen, Soziale Dreigliederung zu verwirklichen?
Lars Grünewald: Zunächst ist die Soziale Dreigliederung von Rudolf Steiner ja durchaus als ein sozialpolitisches Konzept gedacht; es geht um die Umgestaltung und Gliederung des gesellschaftlichen Lebens nach den drei Gebieten Geistesleben, Wirtschaftsleben und Rechtsleben. Wir sind aber meines Erachtens heute weiter denn je davon entfernt, so etwas im gesellschaftlichen Raum ganzheitlich verwirklichen zu können; und dies im Wesentlichen aus drei Gründen: Zunächst lassen die machtpolitischen Strukturen dies nicht zu; unser politisches System ist – insbesondere seit der Etablierung der EU – quasi vollständig, was die Gesetzgebung und die Machtstrukturen angeht, von oben her bestimmt. Zweitens haben die Massenmedien eine ungeheure Macht, die sich entweder in den Händen der Politik oder des Großkapitals befindet. Diese Gruppen können an einer Dreigliederung kein Interesse haben und würden durch entsprechenden Medieneinsatz verhindern, dass sich solche Ideen in größerem Umfang in der Bevölkerung etablieren können.
Soziale Dreigliederung würde eine Auflösung politischer und wirtschaftlicher Machtstrukturen bedeuten.
C. P.: Warum?
L. Grünewald: Soziale Dreigliederung würde eine Auflösung politischer und wirtschaftlicher Machtstrukturen bedeuten. Eine wirkliche Demokratie und eine Wirtschaft, die auf der Assoziation von Konsumenten und Produzenten basiert, und eine kapitalistische Wirtschaft, in der der wirtschaftlich Mächtige das Angebot und die Preise bestimmt, schließen einander aus. Deswegen ist die Soziale Dreigliederung eine Bedrohung für die gesellschaftlichen Eliten. Daher will der Staat das Schulwesen weiterhin gestalten, und die Besitzer der Medien haben kein Interesse daran, alternative Ideen ins öffentliche Bewusstsein kommen zu lassen.
Ein dritter Aspekt ist schließlich das allgemeine Bildungsniveau der Bevölkerung. Es bedarf eines erheblichen Bildungsniveaus, um soziale Dreigliederung umsetzen zu können. Würde die Dreigliederung per Gesetz verordnet, wäre die Bevölkerung gar nicht in der Lage, die entsprechenden Vorgaben umzusetzen; vielmehr entstünde Chaos auf allen Ebenen, nämlich wirtschaftliche und politische Verelendung mit ihren gesellschaftlichen Folgen.
C. P.: Soziale Dreigliederung ist also nach deiner Meinung eine unrealistische Utopie?
L. Grünewald: Ja, solange die Bildung und Ausbildung der Menschen nicht Schritt hält mit dem, was innerhalb dreigegliederter Strukturen nötig wäre.
Friedrich Schiller stand vor einer ähnlichen Situation: Die französischen Revolutionäre wollten die Ideale der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verwirklichen, stattdessen entstand ein unglaubliches Chaos. Daraus hat Schiller den bemerkenswerten Schluss gezogen: Bevor sich die Gesellschaft harmonisieren lässt, muss man Harmonie in den einzelnen Menschen bringen.
Das gilt auch für die Dreigliederung: Bevor die drei Prinzipien Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit nicht im einzelnen Menschen realisiert sind, braucht man an eine gesellschaftliche Veränderung gar nicht zu denken.
primär ein Projekt der Selbsterziehung
Insofern sehe in der Sozialen Dreigliederung primär ein Projekt der Selbsterziehung. Nur in dem Umfang, indem dies gelingt, kann sich zeigen, was im äußeren Rahmen möglich ist, ob man sich mit einzelnen Menschen, mit einzelnen Arbeits- oder Interessensgemeinschaften zusammentun kann, die besser funktionieren als die bereits bestehenden. Und derartige Zusammenschlüsse können dann Wirkungen im gesellschaftlichen Raum haben, indem sie als Vorbilder wirken. Das sind aber Perspektiven, die erst realistisch werden können, nachdem eine entsprechende Selbsterziehung stattgefunden hat.
C. P.: Soziale Dreigliederung heißt: Freiheit im Geistesleben, Brüderlichkeit, bzw. Solidarität im Wirtschaftsleben und Gleichheit im Rechtsleben. Wie würde das sozusagen im Inneren des Menschen aussehen?
L. Grünewald: Ich möchte zunächst von den Begriffen Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben Abstand nehmen und auf die drei Ursprungsprinzipien Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit eingehen.
Meines Erachtens führt der Weg der Selbsterziehung durch drei Stadien durch: Als Erstes gilt es zu erkennen, was diese Prinzipien wirklich bedeuten und in welchem Bereich sie jeweils angemessen sind. Das ist eine theoretische Frage, die sich auch als Bildungsfrage betrachten lässt. Es geht darum, genügend an diesen Begriffen zu arbeiten, um ein klares Verständnis von ihnen zu erlangen.
Das zweite Stadium ist die Herausbildung der Fähigkeit, das eigene Handeln bewusst so zu steuern, dass man lernt, mit diesen Prinzipien zu arbeiten. Ich kann das überall da lernen, wo ich Entscheidungen treffen und handeln muss – da entscheidet sich, wie diese Prinzipien wirksam werden. Das in seiner eigenen Lebensgestaltung bewusst vollziehen zu können, ist eine Übungsfrage.
Den dritten Schritt sehe ich darin, die gewonnenen Fähigkeiten auch wirklich zu nutzen, also beim Freiheitsprinzip beispielsweise nicht nur zu wissen, wo die Freiräume sind, sondern auch, wie sich diese im Sinne eines produktiven Geisteslebens verwirklichen lassen: Steiner verankert das Freiheitsprinzip im Geistesleben, weil es dort im besten Sinne produktiv sein kann.
C. P.: Kannst du das konkreter beschreiben?
L. Grünewald: Das Geistesleben geht zunächst von den eigenen Neigungen aus, also von der Frage: Was will ich gerne vollbringen, und welche Fähigkeiten brauche ich dafür? Wie schaffe ich es, mir diese Fähigkeiten anzueignen? Ich verwirkliche Freiheit im Geistesleben, wenn ich mir beispielsweise meine Bildungsziele selber setze und meine Arbeitsmethoden selber auswähle. Die einzige „Belohnung“ für diese eigene Bildungsanstrengung ist, dass ich hinterher die Fähigkeiten besitze, die ich gerne haben möchte, um damit etwas Bestimmtes zu erreichen.
Mit dem Zur-Verfügung-Stellen von Fähigkeiten kommen wir vom Freiheitsprinzip zum Brüderlichkeitsprinzip.
C. P.: Und wo kommt dann der Punkt, dass man für andere arbeitet und nicht nur bestimmte Fähigkeiten entwickeln will?
L. Grünewald: Das schließt einander nicht aus, denn das Motiv, warum ich diese Fähigkeiten brauche, kann ja sein, dass ich anderen Menschen etwas zur Verfügung stellen will. Wenn ich beispielsweise einen pädagogischen Impuls habe und andere in der Entwicklung ihrer Fähigkeiten fördern will, dann muss ich zunächst mich selbst dafür ausbilden. Mit dem Zur-Verfügung-Stellen von Fähigkeiten kommen wir vom Freiheitsprinzip zum Brüderlichkeitsprinzip.
C. P.: Wie schließt sich dieses Prinzip der Brüderlichkeit, das man korrekterweise auch Schwesterlichkeit oder auch Solidarität nennen könnte, da an?
L. Grünewald: In einem Ausmaß, das mir zunächst freisteht, kann ich schauen, welche Bedürfnisse andere Menschen haben und wie weit ich darauf eingehen und sie unterstützen möchte. Das muss nicht automatisch eine Gegenleistung zur Folge haben; wenn ich für jemanden arbeite, der wesentlich jünger ist oder kein Einkommen hat, kann ich mich u. U. entschließen, ihm meine Leistungen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Aber irgendwoher brauche ich auch Geld. Und da bin ich auf die Brüderlichkeit meiner Gegenüber angewiesen. So entsteht die Möglichkeit eines Leistungsausgleiches, einer gegenseitigen Leistungsverabredung, wie sie für das Wirtschaftsleben charakteristisch ist.
C. P.: Es gibt Freiheiten, Verpflichtungen und auch vermeintliche Verpflichtungen. Wo liegen da die Grenzen?
Freiheit zu entfalten bedeutet auch immer, den eigenen Vorstellungsinhalt dessen, was man für möglich hält, zu erweitern.
L. Grünewald: Beispielsweise halten Menschen an Konventionen fest und meinen, im Sozialen dieses oder jenes nicht tun zu können, weil es z.B. dem eigenen Ansehen schadet – sich vielleicht von einer Beziehung zu trennen, eine bestimmte Arbeit aufzugeben, Wünsche anderer auszuschlagen oder einen unkonventionellen Berufsweg zu gehen. Das sind alles Bereiche, die in der eigenen Freiheit liegen, wo man sich aber zunächst frei machen muss von einer vermeintlichen Verpflichtung, die man zumeist als Norm übernommen hat. Freiheit zu entfalten bedeutet auch immer, den eigenen Vorstellungsinhalt dessen, was man für möglich hält, zu erweitern. Das funktioniert wohl am besten über die beiden Fragen: Was will ich eigentlich, wenn ich wirklich auf mich höre? Und, falls ich Normen infrage stelle: Muss das wirklich so sein, oder geht es auch anders?
Die Gegenbewegung, die vom Rechtsleben her kommt, ist die, dass ich mir meiner Verpflichtungen bewusst bin. Ich habe es einige Male erlebt, dass Menschen einen Vereinsvorsitz übernommen haben und dachten, sie könnten ihr Amt völlig frei gestalten. Sie haben sich nicht um ihre rechtlichen Verpflichtungen gekümmert und den Verein dadurch fast ruiniert. Wenn ich ein Amt übernehme, muss ich die rechtlichen Bestimmungen kennen und ihnen auch Rechnung tragen: Wenn ich Verantwortung übernehme, bin ich nur noch bedingt frei.
Welche Berechtigung hat jeweils das Freiheitsprinzip, das Gleichheits- bzw. Verbindlichkeitsprinzip und das Brüderlichkeitsprinzip?
C. P.: Wenn man ein alltägliche Beispiel anschaut: In einer Familie muss ein Kind ins Bett gebracht werden. In welchem Verhältnis stehen da Freiheit, Rechtsleben, Brüderlichkeit?
L. Grünewald: In diesem Fall habe ich es auf der einen Seite mit einem bedürftigen Wesen zu tun, das meinen Spielraum in Bezug auf das, was ich verantworten kann, einschränkt. Das Kind hat ein Recht darauf, beizeiten ins Bett gebracht zu werden, in Rücksichtnahme auf seine Gesundheit und sein Wohlbefinden. Daraus erwächst dem Erziehenden eine Verpflichtung. Wenn ich einen Partner habe, mit dem ich mich diesbezüglich abwechseln kann, dann wäre es eine Frage der Brüderlichkeit, ob wir uns abstimmen können in Rücksichtnahme auf uns selber und auf den anderen. Falls das Kind schon älter ist, kann das auch eine Verabredung mit dem Kind selbst sein: Es nimmt auf die Erwachsenen Rücksicht und umgekehrt. Wir schauen beide auf unsere beiderseitigen Bedürfnisse und gleichen uns diesbezüglich aus. Und dazu kommt dann als Drittes mein Freiraum, innerhalb gewisser Grenzen z.B. sagen zu können: „Jetzt noch nicht, ich möchte noch eine viertel Stunde etwas zu Ende bringen.“
Anhand eines solchen Falles können wir uns deutlich machen: Welche Bedeutung und Berechtigung hat jeweils das Freiheitsprinzip, das Gleichheits- bzw. Verbindlichkeitsprinzip und das Brüderlichkeitsprinzip, das man auch als Prinzip der wechselseitigen Unterstützung bezeichnen könnte?
An solchen Kleinigkeiten kann ich lernen, wie ich bewusst diese drei Elemente miteinander ausbalancieren und so im Idealfall die „innere Harmonisierung des Menschen“ (Friedrich Schiller) zustande bringen kann.
C. P.: Es gibt im realen Leben in Bezug auf Freiheit und Verpflichtung zwei Extreme: Im ersten Fall sind das Menschen, die ständig mit Ihrer Selbstverwirklichung beschäftigt sind oder ihren Neigungen nachgehen. Das andere Extrem sind diejenigen, die in festen Strukturen und Sachzwängen gefangen sind.
Ein konkretes Beispiel für eine extreme Einseitigkeit des Rechtslebens und der Verbindlichkeit wäre ein Vater von mehreren Kindern: Er muss Geld verdienen, vielleicht in einem Beruf, der ihn 8 bis 10 Stunden am Tag fordert; vielleicht ist die Arbeit so, dass er in einem vorgegebenen Rahmen handeln muss, vielleicht ist noch ein Haus abzubezahlen usw. Viele Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und Freiheit gibt es da nicht. Oder doch?
Was die einzelne Situation an Manövriermasse hergibt, kann man nur im Konkreten herausfinden.
L. Grünewald: Das kann ich nicht global beurteilen, weil das von seiner individuellen Situation abhängt. Ich kenne Menschen, die sich genau in so einer Situation befinden. Die haben etliche Verpflichtungen übernommen, insbesondere durch ihre Kinder, und sie haben zunächst keine wirtschaftlichen Alternativen. Man muss dann im Einzelfall genau untersuchen, ob man etwas so umschichten kann, dass man vielleicht mehr zuhause arbeiten kann, um mehr Freiräume zu bekommen: Was die einzelne Situation an Manövriermasse hergibt, kann man nur im Konkreten herausfinden. Diejenigen, die ich kenne und die in so einer Situation sind, wünschen sich, mehr Zeit für sich zu haben und versuchen deswegen so geschickt wie möglich, ihre Anliegen aufeinander abzustimmen. Und das führt immer dazu, vermeintliche Notwendigkeiten auf den Prüfstand zu stellen und ernsthaft zu fragen, ob es wirkliche Notwendigkeiten sind oder ob sie Freiraum für Veränderungen hergeben.
C. P.: Und was ist mit denjenigen, die nur für sich und ihre Verwirklichung leben?
L. Grünewald: Zunächst ist die Frage, ob sie es anders haben wollen. Es kann durchaus sein, dass sie durch ihre Biografie zu einem Stadium hingeführt werden, in dem sie ihr momentaner Lebensinhalt nicht mehr erfüllt. Vielleicht hat sich das, was sie aus sich selbst produzieren können, erschöpft; es fehlt an Anregungen von außen, und sie würden gerne mehr Verantwortung übernehmen.
Biografische Umwälzungen?
C. P.: Wenn du das so darstellst, hört sich das soweit alles gut und richtig an. Was wären aber sozusagen die Fingerübungen dafür, um zu erkennen, ob man in Konventionen gefangen ist, wo man sich andererseits frei machen könnte? Es sind mitunter biografische Umwälzungen, beispielsweise sich von den Eltern und der eigenen Erziehung loszulösen oder von internalisierten Mustern, beispielsweise immer etwas für andere tun zu wollen oder umgekehrt sich immer versorgen lassen zu wollen.
Stabilität, Distanz zum eigenen Seelenleben, eigene Entfaltung
L. Grünewald: Wirklich konsequente Selbsterziehung ist immer eine biografische Umwälzung. Sie findet deswegen statt, weil ich sie will oder brauche, sonst würde ich mir diese Mühe nicht antun.
Die elementarste „Fingerübung“ ist die regelmäßige Reflexion. Ohne regelmäßige Gedankenarbeit komme ich nicht zu neuen Begriffen und bekomme kein bewusstes Verhältnis zu meiner eigenen Lebenssituation. Dazu muss ich mich immer wieder fragen: „Was habe ich da gemacht? Was steht jetzt vor mir? Was lerne ich aus meinen Erfahrungen“ usw. Solche Reflexionen sind die Voraussetzung, um mich in einzelnen Situationen bewusst für ein bestimmtes Verhalten zu entscheiden und meine Entscheidung konsequent umzusetzen.
Beim Verbindlichkeitsprinzip geht es primär darum, genügend Stabilität zu entwickeln, um Pflichten wirklich so zu erledigen, wie sie es erfordern; im Idealfall also möglichst effizient, weil es darum geht, sie zu straffen, um Räume frei zu bekommen. Rechtsleben setzt immer voraus, sich von seinem eigenen Seelenleben zu distanzieren, denn das Rechtsleben ist etwas Anonymes; es gilt für alle Menschen gleichermaßen, und deswegen spielt die einzelne menschliche Persönlichkeit dabei keine Rolle: Wenn etwas getan werden muss, dann steht das im Vordergrund und nicht, ob ich Lust dazu habe oder nicht.
Das Freiheitsprinzip ist das Gegenteil, hier geht es um die eigene Entfaltung. Da muss ich mich ständig selber im Bewusstsein haben und überlegen: Was will ich als Nächstes tun? Sobald ich abschalte und nur noch mechanisch das tue, was ich mir vorgenommen habe, bin ich schon wieder im Rechtsleben, weil ich es als meine Verpflichtung ansehe. So kommen Menschen bei dem, was sie tun, oftmals in eine bewusstlose, mechanische Tätigkeit hinein. Dann geht es darum, mit einer bewussten Entscheidung einzugreifen: Vielleicht habe ich mir vorgenommen, eine Stunde lang zu arbeiten, stelle aber nach 45 Minuten fest: Ich komme hier nicht weiter. Solle ich mich jetzt dazu zwingen? Das wäre Rechtsleben, also Verpflichtung. Stattdessen könnte ich sagen: Mein Vorhaben war nur eine ungefähre Disposition, und wenn ich nicht richtig weiterkomme, lasse ich es erst mal sein. Das wäre eine freie Entscheidung. Freie Entscheidungen müssen immer bewusste Entscheidungen sein und setzen also ein erhöhtes Maß an Selbstbewusstsein voraus.
So kann ich jede einigermaßen bedeutsame Entscheidung unter dem Gesichtspunkt der drei sozialen Fundamentalprinzipien betrachten und damit verhindern, in eine Einbahnstraße hinein zu laufen: immer frei sein zu wollen, mich immer anzupassen oder immer die Abstimmung mit anderen zu suchen und ein Opfer des Helfersyndroms zu werden. Alle diese Einseitigkeiten führen zu Schäden; deswegen geht es darum, das Entscheidungszentrum des Menschen – mein Ich – wieder frei zu bekommen und diese drei Prinzipien durch das Treffen bewusster Entscheidungen zu harmonisieren. Und erst wenn ich diese Prinzipien in meinem Handeln gezielt einsetzen kann, kann ich im Sinne der Dreigliederung sozial wirksam werden.