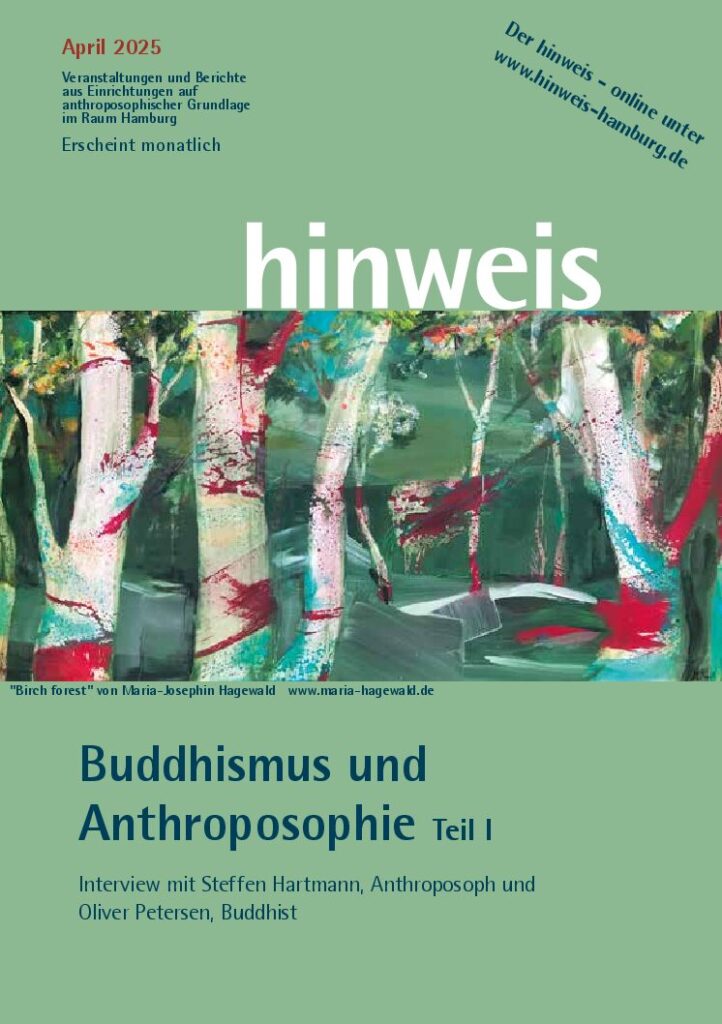Willkommen auf der Seite für Adressen, Veranstaltungen und Berichte aus Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage im Raum Hamburg
Worum geht es im Alter?
Über die Bedeutung der dialogischen Kultur in Alteneinrichtungen
Interview mit Rembert Rauchbach, Geschäftsführer und Projektbegleiter von Alterseinrichtungen

Einsamkeit im Alter – das Kernproblem, dem wir immer mehr begegnen. Wie kommt man im Alter zu Begegnungen und Beziehungen, sei es in einer betreuten Wohnform oder in der Altenpflege. „Dialogische Kultur“ ist das Stichwort, das Einrichtungen für alte Menschen ermöglichen müssen, um attraktiv und gut zu werden.
Auch für uns selbst mit unserer Angst vor dem Alter ist die beste Prophylaxe die Umdrehung der Verhältnisse: nicht das Verdrängen wovor man sich fürchtet, sondern fragend auf den Mit-Menschen zugehen. „Das Du – das andere Ich – erhält und entwickelt mich, mein ICH.“
Rembert Rauchbach, Jahrgang 1948, Rentner. Er begann im Alter von 33 Jahren als Geschäftsführer einer Waldorfschule sich mit seinem Lebensthema „Altersvorsorge und -versorgung“ zu beschäftigen; 1985 gründete er die „Hannoverschen Kassen“ und impulsierte 20 Jahre lang deren Entwicklung. Danach übernahm er die Geschäftsführung des Friedrich-Rittelmeyer-Hauses (Alten- und Pflegeheim) in Hannover und versucht z.Zt. in Ederhöhe (Bad Berleburg) den Generationswechsel so zu unterstützen, dass eine gute Zukunft für die Einrichtung gesichert werden kann. „Zunächst hat mich bei diesem Thema nur der Aspekt des Geldes beschäftigt; erst nachdem ich mich dem 60. Lebensjahr näherte kam ich mehr und mehr zum Wesentlichen: der Begegnung von Mensch zu Mensch, die in der Zuneigung und Mitleid zu der Frage führt: Was fehlt Dir? Kann ich Dir helfen? Das ist es, worum es im Alter wirklich geht.“
C. P.: Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrer Praxis der Altersheime gemacht?
Rembert Rauchbach: Im Friedrich-Rittelmeyer-Haus standen wir vor der Notwendigkeit, dass ein neues Pflegeheim gebaut werden musste, weil in dem bestehenden Haus die normalen Standards nicht mehr erfüllt werden konnten. Das hat auch zu einem Überdenken der internen Prozesse geführt: Wie führen wir ein Pflegeheim? Wir haben kollegiale d.h. dialogische Kultur geübt; das veränderte einerseits das „Betriebsklima“ (die Beziehung zwischen den Pflegenden) und anderseits wurde deutlich, dass das Verhältnis zwischen den Pflegenden und Bewohnern der wesentliche Punkt ist. Das Fachwort dazu ist: Beziehungspflege. Die Bewohner müssen den Menschen kennen und eine Beziehung zu den PflegerInnen haben, die sie pflegen. Das Wort beschreibt das Problem und kennzeichnet dessen Lösung. Auch die AltenpflegerInnen wirken vorbildlich (mitmenschliche Atmosphäre bildend), wenn sie untereinander eine gute Beziehung pflegen und nicht wortlos nebeneinander ihre schwere Arbeit verrichten. Als Beispiel: Jemand hat ein Problem mit einer Kollegin; dann gilt: „Beschwere dich nicht bei deinem Vorgesetzten, sondern gehe selber zu dem Menschen, mit dem du das Problem hast, und bespreche es mit ihm. Und nur wenn das nicht fruchtet, hole dir Hilfe bei Kollegen oder der Leitung.“ Das musste geübt werden, weil es nicht selbstverständlich ist.
Diese drei Formen gehören zusammen: betreutes Wohnen, ambulanter Dienst und stationäre Pflege.
Nach dem Neubau des Friedrich-Rittelmeyer-Hauses in Hannover ist das bisherige Altenpflegeheim in ein betreutes Wohnen umgebaut und ein ambulanter Dienst gegründet worden. Diese drei Formen gehören (im Idealfall) zusammen: betreutes Wohnen, ambulanter Dienst und stationäre Pflege. Das sind zwar getrennte Betriebe, müssen aber unbedingt zusammenarbeiten.
So können die Menschen in ihrem Zuhause mit steigendem Pflegebedarf bis zum Tod begleitet werden. In den betreuten Wohnformen können die aktiven Bewohner in ihrer Eigeninitiative angesprochen und gefördert werden. Die unmittelbare Begegnung und Hilfe von Mensch zu Mensch – zum Nachbarn – zum Nächsten – ist das Ideal.
C. P.: Und was waren Ihre Erfahrungen im Haus Ederhöhe?
R. Rauchbach: In Ederhöhe wird schon seit 1954 versucht, dieses Ideal zu verwirklichen. Dort gibt es ein betreutes Wohnen, einen großen ambulanten Dienst und die stationäre Pflege. Die ambulanten Wohnformen sollen die stationäre Pflege immer mehr ersetzen (siehe folgenden Text). Wir versuchen aber, die stationäre Pflege in kleinem Umfang zu erhalten, weil wir täglich erfahren, dass sie wirklich gebraucht wird. Und in kleinen Einrichtungen mit familiärem Charakter ist eine gute Beziehung – eine dialogische Kultur – leichter zu pflegen als in großen Häusern. Natürlich sind ein schönes neues Haus und eine gute Ausstattung wichtig und notwendig. Gut für die Bewohner ist es aber da, wo Menschen beziehungsstiftend und beziehungspflegend tätig sind.
C. P.: Viele haben Angst davor, wie man das Alter verbringen könnte, bzw. wie man es eben nicht verbringen möchte: alleine und allein gelassen, isoliert, körperlich eingeschränkt bis hin zu pflegebedürftig; man hat Angst vor einem Altersheim, in dem die Devise gilt: satt, sauber, still gestellt und ansonsten keine Zuwendung. Das alles wollen wir nicht. Welche Ideen haben Sie, wie das anders machbar ist?
Welche Wege aus der Einsamkeit gibt es?
R. Rauchbach: Das Thema, das bei dieser Frage angesprochen wird, heißt: Wie entkomme ich der Einsamkeit. Welche Wege aus der Einsamkeit gibt es?
Wir alle sind einsam, müssen einsam sein, jeder, der keine Einsamkeit erlebt hat, dem fehlt eine wichtige Erfahrung. Das gilt für alle Lebensphasen. Im Alter ist entscheidend, ob und wie jeder auf seine Weise durch die Einsamkeit hindurchgekommen ist und jeden Tag neu hindurchkommt. Das gelingt nicht, wenn der Fernseher den ganzen Tag läuft oder andere Geräuschberieselungen das Gefühl vermitteln: Da ist jemand, ich bin gar nicht allein. Es geht um die Frage, wie man eine Beziehung zu anderen Menschen findet. Wie kann man das Gefühl „verlassen zu sein“ überwinden und ein gemeinsames Erleben mit Anderen – den Nächsten – möglich werden?
Diese Frage kann jeder nur auf seine ganz individuelle Weise beantworten. „Satt, sauber, still gestellt zu werden“ ist für die Betroffenen entwürdigend; leider trifft man es in vielen Einrichtungen an, und manchmal ist es auch wirklich nicht zu umgehen. Aber die Menschen sind unglücklich und einsam.
Die Unfähigkeit, belastbare Beziehung herzustellen und zu pflegen.
Ursächlich für dieses Problem ist m.E., dass verschiedene Entwicklungen – insbesondere die technische – dazu geführt haben, das oftmals nur noch „Scheinbeziehungen“ hergestellt werden können, die dann, wenn sie „belastet“ werden, nichts tragen können und deshalb der Weg zum anderen Menschen nicht mehr gefunden werden kann. Diese Unfähigkeit zur Begegnung und dazu, belastbare Beziehung herzustellen und zu pflegen, ist eine Krankheit der Gesellschaft, die besonders in der Altenpflege wahrnehmbar ist.
C. P.: Kommen bei dem Thema Einsamkeit nicht verschiedene Aspekte zusammen? Im Alter werden manche Menschen immer eigener und wollen viele Kontakte gar nicht mehr, auch wenn sie dann daran leiden. Zum anderen braucht es eine bessere Finanzierung, die die Gesellschaft in diesem Bereich nicht bereitstellt.
R. Rauchbach: Die Altenpflege wird viel zu schlecht bezahlt; es gibt einen großen Geldbedarf. Ich glaube aber nicht, dass es nur an dem riesigen Geldmangel liegt, sondern daran, wie wir darüber denken.
Qualität soll dadurch erreicht werden, dass die AltenpflegerInnen jede Menge Standardforderungen erfüllen müssen, die dann vom MDK geprüft werden. Der MDK kann aber nur Ergebnisqualitäten – das was aufgeschrieben (dokumentiert) ist – feststellen; menschliche Zuwendung wird digitalisiert, die Arbeit ist zeitlich getaktet. Diese Form der Bearbeitung des Problems verhindert zwischenmenschliche Beziehung. Das, worum es eigentlich geht, wird gar nicht wahrgenommen und bearbeitet.
Damit will ich sagen: Mit noch so viel Geld kann zwischenmenschliche Wärme nicht hergestellt werden. Es geht darum ein Klima zu bilden, in dem alle Beteiligten (Leitung, PflegerInnen, Bewohner) sich als Mensch in ihrem Ich – in dem, wie sie wirklich sind und sein wollen – angesprochen fühlen und so aus sich heraus das Beste dem Mitmenschen geben können, was sie haben – sich selbst, so wie sie sind. Auch die Bewohner können und wollen den PflegerInnen etwas geben.
C. P.: Welche Projekte und Erfahrungen haben Sie, wie diese Beziehungspflege belebt oder gelernt werden kann?
R. Rauchbach: Die große Politik fordert: „Ambulant und vorstationär“; also möglichst wenig Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen (weil das die teuerste Form der Pflege ist). Das ist m.E. eine gute auch berechtigte Forderung! Die Menschen, die ambulant hilfsbedürftige Menschen zu Hause in ihren eigenen vier Wänden betreuen und pflegen, müssten ihr Augenmerk darauf richten, wie verhindert werden kann, dass der Hilfebedarf größer wird und dass der von ihnen Betreute in eine stationäre Einrichtung aufgenommen werden muss. Das kann nur gelingen, wenn Beziehungen ermöglicht und gepflegt werden. Den Menschen kann geholfen werden, wenn erfahrbar und erlebbar wird, dass jeder beitragen kann, die Einsamkeit des ANDEREN – des Mitmenschen – zu mildern und wenn er die Erwartung zurückstellt, dass ihm selber geholfen wird. Bildlich gesprochen: Gib gerne, hilf gerne dem Menschen, der vor dir steht, und vertraue darauf, dass Du selbst von hinten gehalten und getragen wirst.
Mit Hilfe der sogenannten Betreuung, die in der Altenpflege inzwischen immer mehr Beachtung findet, könnte in diesem Sinne gewirkt werden – auch in der ambulanten Pflege.
Die Angehörigen suchen Wege, wie sie Zuhause betreuen können.
C. P.: Wie kann man sich das konkret vorstellen?
R. Rauchbach: Oft ist es so, dass die Angehörigen Wege suchen, wie sie ihrem Verwandten ein Zuhause bereiten können, in dem sie bis zum Lebensende bleiben können; dann kann man assistierend helfen und unterstützend darauf hinweisen, wo die eigentliche Problematik liegt: nämlich in der Vereinsamung:
Die Tagesstruktur geht verloren, die Selbstpflege – die Beziehung zu sich selbst wird vernachlässigt, wer sich nicht um sich selbst kümmert, kann auch den Mitmenschen – das Leid des Mitmenschen – nicht mehr wahrnehmen. Die Wohnung wird nicht mehr verlassen. Bewegung und laufen wird eingestellt. Der Rückzug auf allen Ebenen entsteht – das Ich geht verloren.
Die Teams, in denen ich tätig bin, machen Angehörigentreffen, feiern Feste und versuchen, auf möglichst vielen Ebenen eine Beziehung zu den Angehörigen herzustellen. In der Begegnung geht es dann darum, dialogisch sich der beschriebenen Problematik zu nähern. Das „wissen, wie es geht“ schreckt ab, stößt den Mitmenschen zurück. Menschen blühen auf, wenn sie sich einbringen können. „Wie machen wir den nächsten Schritt, damit es uns allen Beteiligten gut geht“ – so intensiviert sich Beziehung.
Wenn ich warte, dass Geld da ist, damit ich etwas tun kann, wird sich nie etwas verändern.
C. P.: Diese Schulungen, von denen Sie sprechen – woher kommen dafür die Gelder?
R. Rauchbach: Wie schon gesagt: dazu sind keine besonderen Gelder nötig. Mit den normalen Pflegesätzen (die natürlich viel höher sein müssten) ist das möglich; mitunter bekamen wir ein wenig Stiftungsgelder geschenkt oder auch von Angehörigen, aber das ist keine Bedingung für eine dialogische Kultur; man muss diese wollen, und dann kann man sie leben. Wenn ich warte, dass Geld da ist, damit ich etwas tun kann, wird sich nie etwas verändern.
Wenn man nach außen so wirkt, dass die Menschen merken „die haben einen Zugang zu dem Wesentlichen“, schafft das ein Klima von Aufmerksamkeit. Wenn nur mit „Strukturqualität“ (perfekter Organisation) versucht wird, eine liebevolle Wärme „herzustellen“ wird es „kalt“ bleiben. Beziehung muss entstehen, sich entwickeln – kann aber nicht hergestellt werden.
C. P.: Das alles bezieht sich auf Menschen, die schon Pflege brauchen. Welche Möglichkeiten gibt es als Vorbereitung auf diese Phase?
R. Rauchbach: Die Menschen, die eine betreute Wohnform aufsuchen, wollen selbstbestimmt leben, wollen für sich selber sorgen und tun dies aus zwei Gründen: erstens weil sie bei steigendem Hilfebedarf die Unterstützung leichter bekommen können und zweitens weil die Menschen um sie herum gleiche oder ähnliche Probleme haben wie sie selbst, nämlich Einsamkeit. Diese Verbindung mit Menschen, die das gleiche Problem haben, gibt eine gute Möglichkeit in dem beschriebenen Sinne zu wirken: gib nach vorn und vertraue darauf, dass du gehalten wirst. M.E. ist das die beste Prophylaxe gegen Alterseinsamkeit.
Aber diese Hülle, in der man schon immer war, ist die größte Gefahr.
C. P.: Ist es aber nicht so, dass die Menschen möglichst lange zuhause leben wollen!?
R. Rauchbach: Das ist einerseits richtig. Andererseits lebten die Menschen beispielsweise in einer Familie mit vier Kindern, und nun wohnen sie in 120 qm ganz alleine. Einerseits fühlen sie, dass Veränderung angesagt ist, andererseits möchten sie gerne in der vertrauten Hülle bleiben. Aber diese Hülle, in der man schon immer war, ist die größte Gefahr. Wer sich für den letzten Lebensabschnitt eine betreute Wohnform sucht, macht einen guten Schritt. Deshalb sind diese Wohnformen auch so stark nachgefragt. In diesen betreuten Wohnformen können mit relativ gutem Erfolg Initiativen angeregt werden, weil die Bewohner dort selbst Aktivitäten ergreifen können und/oder dazu angeregt werden: wir feiern zusammen, frühstücken zusammen, musizieren, machen Ausflüge, gehen einkaufen u.v.a.m. . Diese – zunächst losen – Beziehungen sind Schritte auf dem Weg aus der Einsamkeit.
Dazu kommt, dass in den betreuten Wohnformen die Hilfe der Kinder und Angehörigen freilassend erfolgen kann, weil man nicht zusammenwohnt. Die Angehörigen können kommen und wieder gehen, man kann die Beziehung herstellen und wieder lösen, und das ist für beide Seiten gut.
Generationsübergreifendes Wohnen?
C. P.: Wäre ein generationsübergreifendes Wohnen nicht auch eine Lösung für diese Situation?
R. Rauchbach: Das wird immer wieder versucht und scheitert immer wieder. Alle die Formen, die ich kenne, z. B. „Anders Alt werden“ in Bielefeld, fangen generationsübergreifend an und entmischen sich dann, weil es für die jungen Menschen zu anstrengend ist.
Es ist das Problem von Nähe und Distanz: Man braucht Nähe, aber darf nicht eingesperrt sein. Betreute Wohnformen funktionieren deshalb, weil die Türen zugemacht werden können. Wenn man zwangsweise mit Kindern und Alten in einem Haus zusammenwohnt, hat man beispielsweise die Situation: Weil es den kleinen Kindern schwer fällt, Mittagspausen einzuhalten, fühlen sich die Alten oftmals gestört. Ideal sind zwei getrennte Häuser mit der Möglichkeit der Begegnung: In der Ederhöhe kann sehr schön erlebt werden, dass die betreuten Bewohner sich um die stationären Bewohner kümmern, weil sie nebeneinander wohnen. Sie können wieder in ihre Wohnung zurückgehen; das muss auch so sein, damit sie freiwillig und gerne sich gegenseitig unterstützen.
Die übliche Reaktion ist Verdrängung: Mir geht es gut, mir wird schon nichts passieren.
C. P.: Wie bereitet man sich rechtzeitig auf das Altern vor? Auch in Anbetracht der Lage, dass heute immer weniger Menschen Angehörige haben.
R. Rauchbach: Nach meiner Erfahrung sagen viele: Ich fürchte nicht den Tod, aber Demenz und dass ich nicht mehr für mich selbst sorgen kann. Die übliche Reaktion ist Verdrängung: Mir geht es gut, mir wird schon nichts passieren.
Das Gleiche gilt für das Sterben: Wie will ich sterben, wie mich verabschieden? Es ist wichtig, bewusstseinsmäßig dahin zu greifen, wovor man sich am meisten fürchtet. Der Schlüssel dazu ist die Umdrehung der Verhältnisse, und das kann nur in Gesprächen entstehen. Alleine Bücher lesen und Fernsehsendungen anzuschauen helfen nicht weiter. Das wirkliche Lernen findet im Dialog statt.
Es gibt inzwischen dicke Bücher zur Demenzprophylaxe. Aber wir alle können erleben, dass es kein Rezept gibt, weil es jedem passieren kann. Was kann man trotzdem tun? Natürlich brauchen wir weiterhin die medizinische Forschung, Medikamente, aber nach meiner Meinung ist die beste Prophylaxe: Mach dich auf, überwinde deine Scheu, unzulänglich zu sein, zeig deine Schwächen, gehe mit anderen ins Gespräch und höre ihnen zu. Ich kenne Menschen über 90 Jahre, die innerlich und äußerlich aktiv sind, und man hat den Eindruck, dass es kein Alter gäbe.
C. P.: Wenn man sich an Sie wenden möchte, was kann man tun?
R. Rauchbach: In Beziehung treten mit mir: anrufen, mich besuchen, mit mir sprechen, mir schreiben.
Dipl. Ing. Rembert Rauchbach, Jabel 9, 29439 Lüchow 05841 709574